Podcast
Unser Podcast: BuWi in between. Seit Januar 2023 einmal im Monat, immer in between.
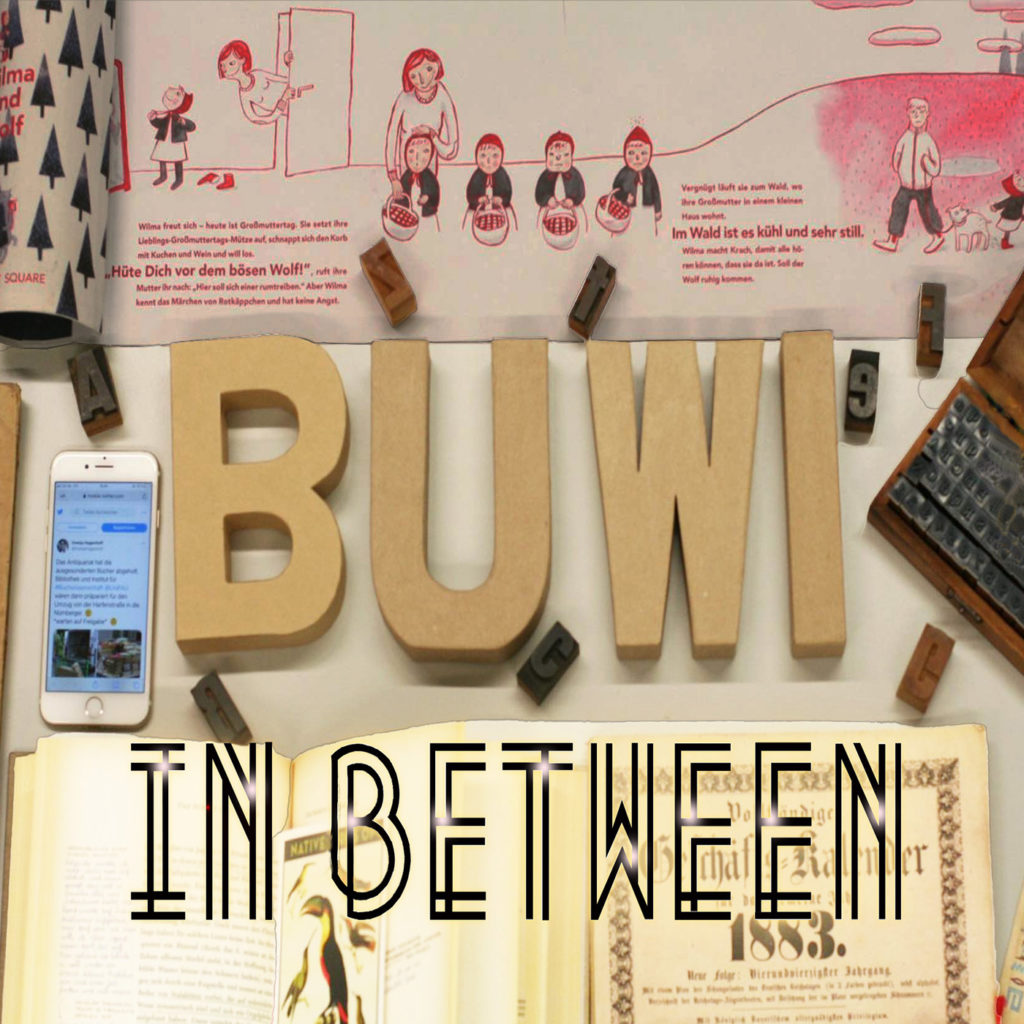
Für alle diejenigen, die nicht Apple Podcasts nutzen, lässt sich BuWi in between bei FAU.tv herunterladen.
Staffel 3, Folge 6: Career in between
Worum es in dieser Folge geht und was wir euch mitgebracht haben
In diese Folge, ‚Career in between‘, steigt Vanessa ab Minute 00:18 mit Vorurteilen ein, die ihr im Zusammenhang mit dem Fach Buchwissenschaft begegnet sind: Dort lese man ausschließlich (Bücher) oder wolle im Bereich Kinder- und Jugendbuchlektorat arbeiten. Auch die Frage, was man im Anschluss an das Studium überhaupt beruflich machen könne, ist nicht unüblich. Laura schließt ab Minute 01:10 mit Berufsfeldern an, die für Studierende der Buchwissenschaft eine Option sein können: Die Medienbranche, die vielfältigen Arbeitsbereiche im Verlagswesen, kulturelle Felder wie beispielsweise Museen oder die Wissenschaft.
Was Karriere ist und wie Selbstverwirklichung damit zusammenhängt
Diese Frage stellt sich Sandra ab Minute 02:45, indem sie auf eine Veröffentlichung des Deutschen Kulturrats aus dem Jahr 2013 eingeht, bei der es um die wirtschaftliche und soziale Lage in Kulturberufen ging. Sie zitiert daraus zentrale Ergebnisse und kommt dann über den Befund „Der Arbeitsmarkt Kultur scheint Chancen der Selbstverwirklichung für den Einzelnen nicht nur zu versprechen, sondern auch zu halten.“ mit Vanessa und Laura ins Gespräch. Vanessa steigt ab Minute 06:01 mit zwei Geständnissen ein: Ihr war nicht von Anfang an bewusst, dass sie eigentlich schon sehr lange Zeit – zumindest als Kulturkonsumentin – Teil der Kulturbranche ist. Sie wollte auch nicht schon immer in diesem Segment arbeiten. Im Verlauf ihres Studiums hat sie gemerkt, dass Selbstverwirklichung für sie bedeutet, kreativen Input zu erschaffen, der greif- und wahrnehmbar ist, was bei ihr im Bereich des Marketing gegeben scheint. Laura reflektiert ab Minute 09:19 die Befunde der Untersuchung anhand ihrer persönlichen Entwicklung. Mit dem Studium ihrer Fächer Buchwissenschaft und English and American Studies mit Schwerpunkt Kulturwissenschaft verfolgt sie das konkrete Ziel, in der Kulturbranche zu arbeiten. Ihr ist es dabei weniger wichtig, viel Geld zu verdienen, sondern vielmehr, Erfüllung in dem, was sie tut, zu finden. Ab Minute 12:18 geht Sandra aus der Dozentinnenperspektive auf den Aspekt der Selbstverwirklichung ein und verrät, dass sie diesen bei sich sowohl in der Lehre als auch in der Forschung realisiert sieht. Sie merkt jedoch an, dass das Resultat ihrer Lehrtätigkeit gerade nicht ‚greifbar‘ ist. Für sie spielt daher Leidenschaft eine wesentliche Rolle, da sie dazu beitragen kann, dass Studierende die Inhalte besser/leichter aufnehmen und nachvollziehen können. Es ist ihr deshalb auch ein Anliegen, Studierenden komplexe Inhalte leichter verständlich zu machen. Als Wissenschaftlerin ist es ihr im Sinne der Selbstverwirklichung wichtig, solche Themen zu bearbeiten, die ihr am Herzen liegen. Allerdings stehen dem teilweise gewisse Forschungstrends und Moden ebenso entgegen wie andersgeartete studentische Interessen.
Wissenschaft als Berufsziel
Nach Sandras Insights gehen Vanessa und Laura ab Minute 32:34 darauf ein, ob eine Tätigkeit im Bereich der Wissenschaft für sie vorstellbar wäre. Vanessa erachtet diesen Bereich als zu herausfordernd, als dass sie dort arbeiten wollen würde. Für Laura kam dies bislang aufgrund ihrer eigenen Biografie nicht in Frage, so dass sie ihre festgefahrene Vorstellung von Wissenschaft zunächst einmal ablegen müsste. Sandra geht in diesem Zusammenhang darauf ein, dass es oftmals Impulse von außen braucht, um das eigene Potential zu erkennen.
Zusammenfassung und Learnings
Ab Minute 39:45 fassen Sandra, Vanessa und Laura ihre Learnings, bezogen auf die gesamte 3. Staffel von BuWi in between, zusammen. Sandra führt aus, dass das übergeordnete Staffelthema, ‚Entwicklung‘, sich weniger allein über Zahlen fassen lässt, sondern dass es die Wechselwirkung ist aus einzelnen Phänomenen und Akteuren, dem Zusammenspiel mehrerer Akteure und dem Einwirken von äußeren Faktoren wie generellen Rahmenbedingungen. Für Vanessa sind es die vielfältigen Themen und Bereiche, in die sie eintauchen konnte und bei denen sie neugierig ist, wie sie sich noch weiterentwickeln werden. Vanessa nennt die zahlreichen sich wechselseitig beeinflussenden Perspektiven, die bei Entwicklungen eine Rolle spielen, und dass die Aspekte ‚Unsicherheit‘, ‚Umstrukturierung‘ und ‚Risiko‘ dabei eine Rolle spielen oder spielen können.
Unser Denkanstoß für euch
Ab Minute 42:37 gibt Laura als Denkanstoß darüber nachzudenken, wie die Zuhörenden auf das Thema ‚Entwicklung‘ blicken und welche Facetten sie diesbezüglich ausmachen.
Das war’s mit der letzten Folge und dem Podcast BuWi in between! Danke für’s Zuhören!
Was macht man in der Buchwissenschaft – in der Lehre und nach dem Studium?
Nida-Rümelin, J. (2006). Hochschulpolitik und die Zukunft der Geisteswissenschaften. In: Aus Politik und Zeitgeschichte.
Schulz, G., Zimmermann, O. und Hufnagel, R. (2013). Arbeitsmarkt Kultur. Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Kulturberufen. Deutscher Kulturrat e.V.
Staffel 3, Folge 5: Orchids in between
Worum es in dieser Folge geht und was wir euch mitgebracht haben
In dieser Folge, ‚Orchids in between‘, erzählt Laura ab Minute 00:17 von ihren persönlichen Erfahrungen, die sie sammeln konnte, als sie noch ein großes Fach studiert hat. Dort waren vor allem Zuständigkeiten ein Problem. Im Unterschied dazu fühlt sie sich beim Orchideenfach, bzw. kleine(re)n Fach Buchwissenschaft sehr gut aufgehoben. Ab Minute 02:30 berichtet Vanessa vom umgekehrten Fall, da sie, bevor sie zur Buchwissenschaft gewechselt ist, ein sehr kleines Fach studiert hat. Sie fühlte sich, ähnlich wie Laura, dort ein wenig allein gelassen und auf sich gestellt.
Was ist ein kleines/Orchideenfach?
Diese Frage diskutiert Sandra mit Laura und Vanessa ab Minute 05:37. Anders, als angenommen, ist ein Fach nicht allein deswegen als klein anzusehen, weil es wenige Studierende gibt, sondern wenn es wenige Professuren und Standorte hat. Für Laura bedingt sich das Ganze allerdings, so dass das Vorhandensein weniger Lehrpersonen zugleich auch weniger Studierende nach sich ziehen sollte. Sandra weist hier auf den Betreuungsschlüssel hin, der sich abhängig von der Relation zwischen Anzahl an Professuren und Anzahl Studierender verändert und eine mehr oder weniger intensive Betreuung der Studierenden zulässt. Ein kleines Fach mit wenigen Professuren, aber einer relativ hohen Studierendenzahl führt somit dazu, dass sich der Betreuungsaufwand der einzelnen Professorin oder des einzelnen Professors erhöht, zugleich zeigt sich daran auch ein starkes Interesse seitens der Studierenden am Fach. Sandra geht in diesem Zusammenhang noch darauf ein, dass weiteres Lehrpersonal nicht mit in die Berechnungen einfließt, obwohl es auch Dozierende gibt, die nicht den Status einer Professorin oder eines Professors haben.
Was ist das Besondere an kleinen/Orchideenfächern?
Ab Minute 15:11 hinterfragt Sandra, weshalb auch und vielleicht besonders kleine Fächer eine ‚Daseinsberechtigung‘ haben. Hierfür zieht sie einen Analogieschluss zur Buchbranche, indem sie auf unabhängige Verlage oder Independent Buchhandlungen sowie Independent Magazine verweist. Auch wenn sich diese Formen zunächst auch dadurch auszeichnen, dass es wenige Mitarbeitende oder Mitwirkende gibt, weisen sie noch weitere Besonderheiten auf. Sie widmen sich Themen, die abseits des ‚Mainstreams‘ liegen. Daraus lassen sich eine bestimmte Haltung und eine spezifische Herangehensweise ableiten, die möglicherweise noch mehr Herzblut und zugleich stärkere Erklärungsnöte mit sich bringen. Solche Formen ebenso wie kleine Fächer beleben gerade die ‚Masse‘. Ab Minute 21:14 hinterfragt Vanessa kritisch, inwieweit das Vorhandensein von kleinen Fächern an Universitäten problematisch ist, weil sie nicht bestimmte Zielvorgaben wie Studierendenzahlen erreichen. Ihrer Meinung nach ergibt sich gerade durch das Nebeneinander von großen und kleinen Fächern eine gewisse Vielfalt, die wiederum attraktiv für Studierende sein kann. Ab Minute 27:20 beleuchten Vanessa und Laura die studentische Perspektive. Vanessa verweist hierzu darauf, dass Studierende, die ein kleines Fach studieren, sich bewusst dafür entschieden haben. Vanessa betont die gemeinsame Interessensbasis, die hier vorhanden ist und auch vorhanden sein muss, sowie die Überschaubarkeit der Beteiligten. Außerdem weist sie auf die Bandbreite an theoretischen Zugriffen und die kreativen Betrachtungsweisen hin. Ab Minute 34:45 bringt Sandra auf den Punkt, dass mit Bezug auf kleine Fächer einerseits von Seiten der Studierenden Leidenschaft sehr wichtig ist. Andererseits braucht es gerade hier Multiplikatoren, die für die Sichtbarkeit von kleinen Fächern sorgen. Dabei spielt es dann auch eine Rolle, dass ein korrektes Bild vom Fach vermittelt wird. Ab Minute 39:12 gehen Vanessa und Laura auf die Berichterstattung zu kleinen Fächern ein. Diese werden dort teilweise als ‚Exoten‘ bezeichnet, teilweise deren besonderen Chancen, die sie bieten, herausgestellt und teilweise deren Relevanz betont.
Zusammenfassung und Learnings
Ab Minute 45:42 fassen Vanessa, Laura und Sandra am Beispiel der Buchwissenschaft zusammen, was die Besonderheit speziell dieses kleinen Fachs ausmacht. Vanessa nennt hier die inhaltliche Bandbreite, Laura betont die Themen, die eine Rolle spielen und Sandra geht auf die zahlreichen interdisziplinären Bezüge ein.
Unser Denkanstoß für euch
Ab Minute 47:48 gibt Sandra als Denkanstoß zu hinterfragen, ob und inwiefern die Größe eines Fachs eine Rolle gespielt hat oder spielt.
Staffel 3, Folge 4: Virtuality in between
Worum es in dieser Folge geht und was wir euch mitgebracht haben
Für diese Folge, ‚Virtuality in between‘, hat Laura einen Börsenblattartikel zu VR in der Buchbranche mitgebracht, in dem auf die ersten Versuche dieser Anwendungsart eingegangen wird. Ab Minute 01:28 tauschen sich Sandra, Laura und Vanessa über ihre Erfahrungen mit VR aus, wobei Sandra und Laura ausschließlich Fremdbeobachtungen schildern können, die deutlich machen, wie intensiv das Erleben beteiligter Personen war, und Vanessa von Berichterstattungen über VR-Anwendungen zu berichten weiß.
Annäherung an VR
Ab Minute 05:28 erzählen Laura, Vanessa und Sandra, wie sie sich generell neue Themen erschließen und wie sie sich konkret mit dem Thema VR vertraut gemacht haben. Laura hat sich vom konkreten Fall, VR-Anwendungen in der Buchbranche, über VR in der Medienbranche allgemein hin zu Unterscheidungen wie AR und VR entlanggearbeitet. Vanessa hingegen betrachtet zunächst das große Ganze, um sich dann auf dessen Unterbereiche zu fokussieren. Sandra wiederum sucht sich konkrete Anwendungsbereiche, die auch aus benachbarten Branchen und Disziplinen stammen können. Ab Minute 09:18 führt Laura in wesentliche Aspekte von VR ein, verdeutlicht den wirtschaftlichen Stellenwert und nennt die Presse als Anwendungsbereich. Sandra geht ab Minute 10:55 auf das Theater als weitere Einsatzmöglichkeit ein und stellt Bezüge zu Literaturveranstaltungen her.
Kritische Auseinandersetzung mit VR
Laura hinterfragt ab Minute 15:25 am Beispiel von Konzerten, welche nachteiligen Aspekte VR mit sich bringen könnte. Ihrer Meinung nach fehlt dabei vor allem das Gemeinschaftsgefühl, sodass es darum gehen könnte, die Entscheidung entweder für eine möglichst realitätsnahe (Publikumsperspektive) oder eine bestmögliche Darstellung (Inszenierungsperspektive) zu treffen. Sandra bestätigt diese Annahme ab Minute 16:50, indem sie sich anhand von Literaturveranstaltungen fragt, ob es um das Erleben eines Miteinanders von Publikumsperson und Bühnengegenüber geht oder darum, ein gelungenes Gemeinschaftsgefühl zu suggerieren. Vanessa macht sich ab Minute 19:40 vor allem für die positiven Aspekte stark, indem sie darauf hinweist, dass VR im Bereich von Kosten und Ermöglichung Vorteile bietet. Sandra greift dies ab Minute 21:14 auf. Sie sieht VR als Entwicklungslinie sowie Chance und macht auf Zusammenhänge zu Varianten, die sich während der Coronaphase entfalten konnten, aufmerksam. Vanessa weist in diesem Zusammenhang ab Minute 24:41 noch darauf hin, dass es nicht zwangsläufig immer auf das (bestmögliche) Erlebnis ankommen muss, sondern es ausreichend sein kann, dass grundsätzlich Teilhabe möglich ist. Ab Minute 29:02 geht Sandra auf eine Studie ein, bei der es darum ging, die Wirkung von Musik, die über ein Video, live oder in Form zweier unterschiedlicher VR-Anwendungen erlebt wurde, zu untersuchen. An der Studie waren Personen aus dem Bereich der VR-Entwicklung sowie Psychologie und Ethik beteiligt, um ein möglichst umfassendes Bild zu bekommen. Es konnte gezeigt werden, dass das immersive Erleben bei VR-Anwendungen am stärksten ausgeprägt ist und dass Erregungszustände noch steigerbar sind. Am Ende der Studie fand sich außerdem ein Appell, vergleichbare Untersuchungen in anderen Kulturbereichen durchzuführen.
Weitere Einsatzbereiche von VR
Ab Minute 35:33 überlegen Laura, Vanessa und Sandra, welche Einsatzbereiche von VR es bereits in der Buchbranche gibt und welche weiteren sich darüber hinaus ergeben könnten. Laura nennt für bereits Bestehendes einige Beispiele vor allem aus dem Bildungsbereich und Vanessa geht auf Aspekte im Bereich der Verlagsorganisation ein. Im Zusammenhang mit weiteren Optionen verweisen Laura und Vanessa auf die Möglichkeit, Bücher in Augenschein nehmen und in sie eintauchen zu können und Vanessa fügt noch den Anwendungsbereich der Literaturveranstaltungen und Messen hinzu. Laura macht den Vorschlag für eine Hörbuch-VR, bei der Hörbücher mit Animationen angereichert werden.
Zusammenfassung und Learnings
Sandra fasst ab Minute 47:42 zusammen, dass sich mit VR interessante Möglichkeiten auftun, die jedoch mit Bedacht umgesetzt werden sollten.
Unser Denkanstoß für euch
Ab Minute 48:53 gibt Laura als Denkanstoß, dass sich die Zuhörenden an ihre bereits mit VR gemachten Erfahrungen zurückerinnern und/oder sich machbare und relevante Einsatzbereiche für die Buchbranche überlegen sollen.
o.V. (2016). Programmierte Erlebnisse. In: Börsenblatt. Das Fachmagazin für die Buchbranche.
Ciepluch, M., Eisenbeis, U. Technologieadoptionsstrategien von Medienunternehmen. Schnelligkeit, Zeitpunkt und Planungshorizonte von Investitionen und Akquisitionen in Augmented und Virtual Reality-Technologien. In: HMD 59, (pp. 389–410).
Dössel, C. (2021). Bastarde von eigentümlicher Schönheit. In: Süddeutsche Zeitung.
Lange, S. (2019). Enhanced E-Books. In: Enhanced E-Books. Eine empirische Studie zum immersiven Erleben (pp. 99–116). J.B. Metzler.
Scorolli, C., Nadei Grasso, E., Stacchio, L, Armandi, V., Matteucci, G. und Marfia, G. (2023). Would you rather come to a tango concert in theater or in VR? Aesthetic emotions & social presence in musical experiences, either live, 2D or 3D. In: Computers in Human Behavior 149.
Staffel 3, Folge 3: Horizons in between
Worum es in dieser Folge geht und was wir euch mitgebracht haben
Vanessa hat das Zitat von Henry Ford, „Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.“ mitgebracht, mit dem sie in die Folge ‚Horizons in between‘ einführt. Sandra nimmt die Zuhörenden ab Minute 00:25 mit und überlegt gemeinsam mit ihnen, welche Dimensionen Können hat. Dies führt sie mit dem Leitbild der Philosophischen Fakultät der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg zusammen, um daraus abzuleiten, was zentrale Fragestellungen eines geisteswissenschaftlichen Fachs wie der Buchwissenschaft sind und welche Voraussetzungen es dafür braucht.
Stärken, Schwächen und Horizonterweiterung aus Studierendenperspektive
Ab Minute 04:20 setzen Sandra, Laura und Vanessa ihre persönlichen Stärken und Schwächen mit dem Leitbild in Beziehung. Für Laura spielen gesellschaftlich-kulturelle Themen und eine entsprechend darauf bezogene Motivation eine entscheidende Rolle. Sie hat eine Vorliebe für die englische Sprache und liest gerne. Vanessa hat ebenfalls eine Stärke für Sprachen und ist sehr gut darin, sich Vokabeln anzueignen. Ab Minute 10:37 bringt Sandra auf den Punkt, dass das mitgebrachte Zitat einerseits auf eine Horizonterweiterung verweist – daher auch der Titel dieser Folge –, es andererseits aber auch darum geht, die persönliche Komfortzone zu verlassen. Bei Vanessa war dies im Zusammenhang mit dem Modul ‚Organisationsleistungen‘ der Fall, weil sich dadurch ihr Interessenfeld und sogar ihr Berufswunsch verändert haben. Anstatt Lektorin werden zu wollen, könnte sie sich nun eine Tätigkeit im Marketing vorstellen. Sie führt ab Minute 12:25 am Beispiel einer Hausarbeit, für die sie sich mit ‚Spektakelbüchern‘ beschäftigt hat, ihre Begeisterung für den Aspekt des Marketings näher aus. Auf Lauras Nachfrage ab Minute 19:04, ob solche Spektakelbücher Vanessas Kauf- und Rezeptionsverhalten verändert haben, geht Vanessa differenziert ein. Laura verrät ab Minute 21:30 ihre Aha-Momente. Den ersten davon hatte sie bereits im Modul Medientheorie, weil ihr dort klar wurde, wie vielseitig die Buchwissenschaft ist. Zugleich eröffnete ihr die Feldtheorie von Pierre Bourdieu einen Erklärungsansatz für ihre persönliche Biografie. Theorien ermöglichen so, wie Sandra ab Minute 25:13 erklärt, selbst eine Art von Horizonterweiterung, weil sie Denkrichtungen aufzeigen, die es kritisch zu hinterfragen gilt. Ab Minute 27:40 offenbart Laura, dass das Podcast-Seminar ebenfalls eine Horizonterweiterung für sie darstellte, da sie die Entstehungsprozesse von Podcasts speziell, aber auch diejenigen von Medienproduktionen allgemein nun besser nachvollziehen kann. Sandra greift diesen Aspekt ab Minute 29:44 auf, indem sie verdeutlicht, welche Punkte hier aus der Dozierendenperspektive eine Rolle gespielt haben.
Stärken, Schwächen und Horizonterweiterung aus Dozierendenperspektive
Ein Thema, das Sandra aus ihrem eigenen Magisterstudium der Buchwissenschaft in ihre Lehrveranstaltungen mitgenommen hat, ist dasjenige der Typografie sowie der Buchkunst, wie sie ab Minute 31:15 verrät. Aus diesem Grund interessieren sie Phänomene wie aufwendig gestaltete Druckmedien, die sie als Gegenbewegung in einer digital geprägten Gesellschaft auffasst, was sich auch mit dem von Andreas Reckwitz formulierten Begriff der Fortschrittsverluste erklären lässt. Über diesen denken Sandra, Laura und Vanessa gemeinsam ab Minute 36:49 nach, indem sie ihn am Beispiel von Schallplatten- und CD-Sammlungen näher ausführen. Ab Minute 40:05 geht Sandra darauf ein, dass sie sich tiefer in den Bereich von Design eingearbeitet hat, um diesen für buchwissenschaftliche Fragestellungen zu erschließen und führt ab Minute 42:58 aus, dass sie sich vor allem mit Theorieansätzen aus dem Bereich der Mediennutzungs- und -wirkungsforschung sowie der Kommunikationswissenschaft und Soziologie auseinandersetzt, um Antworten auf ihre zentralen Fragestellungen zu erhalten. Ab Minute 47:59 verrät sie die Learnings, die sie als Dozentin hatte, beispielsweise, dass Lehrveranstaltungen einer gewissen Dramaturgie folgen sollten oder welche vielfältigen Vermittlungsmöglichkeiten Lernplattformen eröffnen. Darüber hinaus gesteht sie sich ein, dass die beste Lehrmethode nichts bringt, wenn sie von den Studierenden nicht angenommen wird, weshalb sie Lerntagebücher künftig nicht mehr zwangsläufig einsetzen wird, das forschende Lernen hingegen schon.
Zusammenfassung und Learnings
Sandra bringt ab Minute 54:47 auf den Punkt, dass Horizonterweiterung bedeutet, über sich hinauszuwachsen und lebenslang Freude an unbekannten Themen zu haben.
Unser Denkanstoß für euch
Der Denkanstoß dieser Folge kommt ab Minute 55:15 von Vanessa, die die Zuhörenden dazu anregt, über die eigene(n) Horizonterweiterung(en) nachzudenken.
Staffel 3, Folge 2: Developments in between
Worum es in dieser Folge geht und was wir euch mitgebracht haben
Sandra erklärt ab Minute 00:15, dass sich hinter dem Folgentitel Developments in between die Entwicklung der Erlanger Buchwissenschaft verbirgt. Dazu hat sie ihre Scheine, die sie während ihres Magisterstudiums erworben hat, mitgebracht. Der Zusatz ‚historischer Schein‘ besonders auf ihren buchwissenschaftlichen Scheinen hat ihr klar gemacht, wie sehr sich die Buchwissenschaft verändert hat, da es im aktuellen BA Buchwissenschaft keine solche Trennung zwischen historischen und modernen Inhalten mehr gibt. Stattdessen wurden die Studieninhalte entlang einer Matrix strukturiert.
Die Studiengangs-Matrix und was sie bedeutet am Beispiel des Moduls Soziotechnische Systeme
Ab Minute 07:29 führt Sandra in die Studiengangs-Matrix ein, die einer Steigerungslogik folgt. Zu Beginn des Studiums liegt der Fokus auf Grundlagen zu Themen, Begriffen, Erklärungsansätzen und einem ersten Modell, das das Zusammenspiel aus Akteuren und Ressourcen erklärt, die nötig sind, um (schrift- und medienbezogene) Probleme zu lösen. Vanessa erzählt ab Minute 10:10, dass sie in diesem Modul, ‚Soziotechnische Systeme‘, ein Seminar besucht hat, in dem es um die Ressource Papier ging und darum, wie sich diese nachhaltiger erzeugen lässt und welche Akteure und Initiativen dazu notwendig sind. Dieses Zusammenspiel lässt sich anhand eines Dreiecks-Modells abbilden, das Laura ab Minute 13:12 kurz erklärt. Danach geht sie auf das Seminar ein, das sie in diesem Modul besucht hat. Bei ihr ging es um das Smartphone und den Umgang damit als Kulturtechnik. Sie erzählt auch davon, dass die Kursteilnehmenden ihr eigenes Smartphone-Nutzungsverhalten beobachten sollten und welche Herausforderungen es dabei gab.
Die Studiengangs-Matrix und was sie bedeutet am Beispiel des Moduls Organisationsleistungen
Sandra geht ab Minute 22:37 darauf ein, wie es nach den grundlegenden Aspekten im Studium weitergeht. Dazu finden sich sogenannte Kernmodule, in denen es um Fragestellungen geht wie: Wie gehen Menschen und Medien miteinander um? Welche Wechselwirkungen gibt es hier? Wie gestalten sich die kommunikativen Prozesse konkret? Wie werden die Inhalte schriftbasierter Medien erzeugt? Letzteres wird in der Studiengangs-Matrix als ‚Organisationsleistungen‘ bezeichnet. Laura und Vanessa erzählen ab Minute 24:45 von den Seminaren, die sie im entsprechenden Modul besucht haben. Während es bei Laura um Finanzierungsmodelle ging, standen bei Vanessa generelle Wertschöpfungslogiken im Vordergrund. Ab Minute 29:47 fasst Sandra zusammen, dass die Buchwissenschaft als Fach eine große inhaltliche Bandbreite abzudecken in der Lage ist, so dass die Seminare abwechslungsreich sind und sich hinter den Modultiteln mehr verbirgt, als es den Anschein hat – auch weil es sich dabei teilweise um abstrakte Bezeichnungen handelt.
Was uns darüber hinaus noch umtreibt
Vanessa und Laura verraten ab Minute 32:57, welche Aspekte sie gerne noch vertiefender behandeln würden. Beide nennen hier übereinstimmend den Bereich der Mediensozialisation, Laura interessiert sich außerdem für Einflussfaktoren und Wirkmechanismen, die bei der Mediennutzung eine Rolle spielen. Sandra ‚träumt‘ ab Minute 37:45 von Themen, die sie noch in der Lehre einbringen wollen würde, wie beispielsweise, welche Literaturvermittlungsstätten in kleineren und mittelgroßen Städten dazu beitragen, dass Menschen zum Lesen gebracht werden, oder wie sich die Literaturvermittlungsszene aus weiblicher Perspektive gestaltet.
Zusammenfassung und Learnings
Vanessa fasst ab Minute 45:32 zusammen, dass es in der zweiten Folge der dritten Staffel von BuWi in between darum ging, wie sich die Erlanger Buchwissenschaft entwickelt hat und sich noch weiter entwickeln könnte.
Unser Denkanstoß für euch
Laura gibt ab Minute 45:47 als Denkanstoß zu überlegen, welche Inhalte die Zuhörenden außerdem relevant für die Buchwissenschaft fänden.
Staffel 3, Folge 1: Podcasts in between
Worum es in dieser Staffel und dieser Folge geht und was wir euch mitgebracht haben
Laura führt ab Minute 00:14 in die dritte Staffel, deren übergeordnetes Thema „Entwicklung“ lautet, ein und verrät, dass die Themen diesmal aus Dozierenden- und Studierendensicht vermittelt werden. Danach stellen sich Laura, Sandra und Vanessa jeweils mit einem funfact vor: Laura ‚sammelt‘ Indoor-Hobbies, aktuell das Häkeln, Sandra verleiht allem, auch Gegenständen wie dem Mikrophon, eine Stimme und Vanessa glaubt an das Schicksal. Ab Minute 01:39 verrät Sandra, was sie mitgebracht hat. Sie hat in einem Börsenblatt-Artikel die Aussage gelesen, dass der Podcast, der als „[p]ersönlich, meinungsfreudig, innovativ“ bezeichnet wird, boomt. Dies markiert für sie eine zahlenmäßige Entwicklung, zugleich lässt sich aber auch eine inhaltliche Entwicklung ausmachen, da in den weiteren Ausführungen von Wissensvermittlung, die auf unterhaltsame Art und Weise stattfindet, die Rede ist. Hieran schließt sich ab Minute 02:35 eine Diskussion unter Vanessa, Laura und Sandra an, inwiefern der Gegensatz zwischen Wissensvermittlung/Information und Unterhaltung sinnvoll ist.
Podcasts kurz und knapp und unsere Podcast-Hörerfahrungen
Sandra erklärt ab Minute 05:50 Podcasts in a nutshell, indem sie in ihrer inhaltlichen Bandbreite die zwei Kernausprägungen Gesprächsformate jeglicher Form und Podcasts mit fiktionalen Inhalten ausmacht. Als weitere Besonderheiten erkennt sie die durch die Smartphoneverbreitung mögliche Überall-Nutzbarkeit von Podcasts und die Chance, dass prinzipiell jede*r einen eigenen Podcast auf die Beine stellen kann. Ab Minute 08:02 tauschen Laura, Vanessa und Sandra sich über ihre Podcast-Hörerfahrungen aus. Laura konnte anfangs überhaupt nicht nachvollziehen, weshalb sie anderen beim Reden zuhören sollte, doch mittlerweile sind Podcasts fester Bestandteil in ihrem Alltag. Vanessa gesteht, dass sie sich mit Podcasts nicht so richtig anfreunden kann, weil sie ihrer Meinung nach aktives Zuhören voraussetzen, was sich mit den Tätigkeiten, die sie begleitend zum Hören ausführt, nicht gut vereinbaren lässt. Sandra verrät, dass sie viel mehr Podcasts hören würde, wenn sie die Zeit dazu hätte, weshalb sie mittlerweile einen recht ansehnlichen SUP (Stapel ungehörter Podcasts) aufgebaut hat.
Unsere Hörerfahrungen bezogen auf Radio, Musik und Hörbuch
Ab Minute 14:05 sprechen Sandra, Laura und Vanessa über das Radiohören. Bei allen dreien war das Radio in der Kindheit das ‚dauerdudelnde‘ Begleitmedium, das bei den Eltern zuhause oder im Auto spielte. Mittlerweile spielt es bei ihnen eine sehr stark untergeordnete Rolle, auch, weil sie lieber selbstbestimmt eigens ausgewählte Inhalte hören wollen. Ihre Musikerfahrungen teilen Sandra, Vanessa und Laura ab Minute 18:35. Sandra umschreibt ihr Musikhörverhalten mit Hintergrundrauschen, Vanessa dagegen hört sowohl in gestreamter Form als auch über CD vor allem ihre Lieblingskünstler*innen. Laura hört stimmungsbezogene Playlists oder sammelt CDs ihrer liebsten Bands. Ab Minute 26:43 gehen Sandra, Laura und Vanessa darauf ein, ob und wie sie Hörbücher gehört haben und hören. Sandras Forschungsschwerpunkt ist das Hörbuch und sie hört Hörbücher am liebsten ohne Nebenbeschäftigung, in ihrem Hängestuhl baumelnd und über Kopfhörer, um die Sprecher*innen-Stimme ‚im Kopf‘ zu haben. Laura gesteht ihre Vorliebe für Bibi und Tina-Folgen oder bekannte Hörbuch-Titel, die sie gezielt zum Einschlafen hört. Vanessa hat erst vor einem Jahr zu Hörbüchern gefunden, aber auch hier für sich gemerkt, dass Hörbücher nicht ihr Medium sind.
Zusammenfassung und Learnings
Sandra fasst ab Minute 36:42 zusammen, dass in der Folge, ausgehend von der Entwicklung von Podcasts, das Hörverhalten von ihr, Laura und Vanessa nur beispielhaft für generelles Hörverhalten gesehen werden kann, da es zahlreiche Einflussfaktoren gibt, die hierbei eine Rolle spielen.
Unser Denkanstoß für euch
Abschließend gibt Laura ab Minute 38:29 den Denkanstoß, das eigene Hörverhalten zu beobachten und zu reflektieren.
Staffel 2, Folge 6: Interview in action
Worum es geht und die persönliche Empfehlung unseres Gasts, Ann-Sophie Vorndran, M.A., für euch
Die 6. Folge von BuWi in between ist die letzte Folge der zweiten Staffel und für dieses Staffelfinale haben Anne und Janina Ann-Sophie Vorndran, M.A. zu Gast, die am Institut für Buchwissenschaft promoviert. In dieser Folge bringt Ann-Sophie die Empfehlung mit. Ab Minute 1:10 empfiehlt sie, Literaturverwaltungsprogramme, die das Verwalten von Literatur und richtige Zitieren, egal, ob bei der Doktorarbeit, der Bachelorarbeit oder bereits bei den ersten Hausarbeiten, vereinfachen.
Ann-Sophies Werdegang und ihr Volontariat im Verlag
Ab Minute 2:10 erzählt Ann-Sophie, wie sie zur Buchwissenschaft gekommen ist. Sie hat im Bachelor Literatur – Kunst – Medien mit Nebenfach Geschichte in Konstanz studiert und im Rahmen ihres Studiums ein Pflichtpraktikum absolviert. Da sie die Buchbranche kennenlernen wollte, hat sie dieses Praktikum in einem Fachverlag gemacht, bei dem sie später auch ihr Volontariat begonnen hat. Dabei wurde ihr bewusst, dass sie noch mehr an theoretischem Wissen erlangen wollte, auch, weil sie Dinge gerne hinterfragt. Dies führte sie zum Masterstudium und zur anschließenden Promotion bei der Erlanger Buchwissenschaft. Ab Minute 5:35 gibt Ann-Sophie Einblick in die Bereiche, die sie während Praktikum und Volontariat durchlaufen hat. Dabei war sie vor allem bei Marketing und Presse tätig, wo sie beispielsweise für die Organisation von Büchertischen und Reisen verantwortlich war. Außerdem arbeitete sie in Lektorat und Herstellung. Besonders interessant fand sie im Rückblick, was sie alles aus dieser Praktikumserfahrung mitnehmen konnte. Da sie ursprünglich bei einem Belletristikverlag arbeiten wollte, was auch ihr späteres Tätigkeitsfeld werden sollte, musste sie ihre ‚Komfortzone‘ verlassen. So lernte sie einen völlig neuen Arbeitsbereich kennen, von dem sie sich noch keine Vorstellung machen konnte, und war aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen kleineren Verlag handelte, in der Lage, in verschiedenste Abteilungen hineinzuschnuppern und kleinere Projekte zu übernehmen. Ab Minute 7:48 berichtet Ann-Sophie von ihren Learnings wie unvoreingenommen zu sein und über den Tellerrand zu blicken. Ihr wurde außerdem bewusst, welch wichtige Rolle die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, und das Arbeitsklima spielen.
Der Übergang vom Volontariat zum Master und zur Promotion
Ann-Sophie erinnert sich ab Minute 9:00 an ihre Anfänge in Erlangen zurück. Während sie für ihren Bachelor bewusst weiter weg von zuhause gezogen ist, wollte sie für den Master näher am Studienort leben und hat sich mit Nürnberg für eine Stadt mit einem ihrer Meinung nach interessanten Kulturleben entschieden. Sie gesteht, dass sie ihr Volontariat nach etwa einem Jahr abgebrochen hat, vor allem, weil ihr das Hintergrundwissen zu einigen Prozessen und eine genauere Einordnung fehlten. Dies und die Möglichkeit, im Rahmen einer einjährigen Projektarbeit einen forschungsbezogenen Brancheneinblick zu erlangen, führte sie zu ihrem Masterstudium nach Erlangen. Ab Minute 11:35 erzählt sie von ihrem Übergang vom Master zur Promotion. Zuerst hatte sie nicht vor zu promovieren, sondern wollte nach ihrem Master zurück in die Branche. Doch ihre positiven Erfahrungen aus der Projektarbeit und ihre Tätigkeit als studentische Hilfskraft, bei der sie am Forschungsprojekt eines Professors in der Buchwissenschaft mitwirkte, ließen sie umdenken. Für ihre Masterarbeit hat sie Methoden aus den Digital Humanities angewendet, indem sie eine Prozessmodellierung für ein Publikationssystem vorgenommen hat, das in dieser Form programmierbar gewesen wäre. Dies hat sie dann weiter zur Promotion geführt. Von ihrem genauen Arbeitstag und der Organisation ihres Alltags berichtet Ann-Sophie ab Minute 13:20. Das Vor- und Nachbereiten und Halten der Lehrveranstaltungen findet bei ihr in der Regel an einem Tag in der Woche statt. Die anderen Tage widmet sie den jeweils anstehenden Arbeitsschritten ihrer Doktorarbeit. Dabei ist es wichtig, ein solch großes Projekt wie eine Dissertation in kleinere Einheiten zu zerlegen, um diese systematisch, auch mit Hilfe von Deadlines, abzuarbeiten. Dabei helfen Ann-Sophie Erfahrung und Selbstdisziplin.
Das Thema der Promotion, auch in der Lehre
Ab Minute 15:45 geht Ann-Sophie näher auf ihr Thema, das im Bereich der Automated Bookculture verortet ist, ein. Sie betrachtet den Einfluss von technischen Phänomenen auf das Kulturgut Buch. Ausgehend von der Beobachtung, dass die Buchbranche oft scheinbar von technischen Neuerungen überrollt wird (z.B. KI, Chat-GPT), untersucht sie aktuell, wie sich Zuschreibungen auf Innovationsprozesse auswirken. Auf ihre Erfahrungen, wie es ist, ihr Wissen aus der Dissertation an Studierende weiterzugeben, geht Ann-Sophie ab Minute 17:40 ein. Hier ist ihr besonders die unterschiedliche Sichtweise und Herangehensweise von Forschenden und Studierenden aufgefallen. Während erstere offene Fragen als Herausforderung annehmen, wollen zweitere lieber das Endergebnis präsentiert bekommen und tun sich mit Ungelöstem eher schwer. Anne und Janina, die beide ein Seminar bei Ann-Sophie besucht haben, fanden dort gerade den Austausch unterschiedlichster Meinungen und die Diskussionen mit offenem Ausgang spannend. Ab Minute 20:35 gibt Ann-Sophie einen kleinen Einblick dazu, wie sich Zuschreibungen überhaupt aufspüren und greifbar machen lassen, ohne dass sie durch die je individuellen Zuschreibungen der Forschenden überdeckt werden. Dazu hat sie auf ein von einem Kollegen aus den Digital Humanities entwickeltes Tool zurückgegriffen, das Zeitungs- und Zeitschriftenartikel auf spezifische Schlagwörter und Schlagwortkombinationen hin durchsuchbar macht und auch damit in Verbindung stehende Emotionen aufdeckt. Gerade diese sind es, die Diskurse in eine bestimmte Richtung lenken. Ab Minute 25:13 fragt Janina Ann-Sophie nach spannenden Ereignissen oder Dingen, mit denen sie bei der Dissertation nicht gerechnet hat. Hier hebt Ann-Sophie den Prozess der Forschung und die Vielfalt der Buchwissenschaft hervor und betont besonders den Moment, in dem sich ein Gedankenblitz manifestiert, was dazu führt, dass der kreative Prozessor angeworfen wird. Sie gesteht, dass ihr die Lehre sehr viel Spaß macht, womit sie zu Beginn nicht gerechnet hat. Gleichzeitig geht sie aber auch auf die Herausforderung ein, Studierenden Wissen zu vermitteln und sie zur Diskussion zu animieren.
Ann-Sophies Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch
Ab Minute 28:55 hat Ann-Sophie noch eine Mitmach-Aufgabe für die Zuhörenden mitgebracht. Dabei gibt sie vor allem BuWi-Studierenden den Tipp, für mehr Praxiserfahrung eigeninitiativ zu werden und sich in verschiedensten Bereichen auszuprobieren. Hier geht sie auf Nebenjobs in der Buchbranche ein, betont aber auch die Angebote, die beispielsweise der Career-Service der FAU hat, oder empfiehlt den Besuch von Tagungen und Konferenzen.
Ausblick auf die nächste Staffel von BuWi in between
Janina macht ab Minute 31:30 darauf aufmerksam, dass es eine dritte Staffel von BuWi in between mit einigen Neuerungen, wie beispielsweise auch neuen Stimmen, geben wird. Anne und Janina sind in der nächsten Staffel nicht mehr mit dabei und verabschieden sich somit von BuWi in between.
Vorndran, A.-S. (2023), Zuschreibungen: Prozesse der Identifikation, Differenzierung und Bewältigung (Erlanger Beiträge zur Medienwirtschaft Nr. 17).
Vorndran, A.-S. (2021). Kultur & Kreativität: Buch als Kulturgut (Erlanger Beiträge zur Medienwirtschaft Nr. 15).
Staffel 2, Folge 5: Social Media in between
Worum es in dieser Folge geht und unsere Empfehlung für euch
In der Folge „Social Media in between“ sprechen Janina und Laura über Social Media in der Buchbranche. Ab Minute 00:30 erzählt Janina, dass die Folge auf eine Lehrveranstaltung aus dem Bereich der Schlüsselqualifikationen der Buchwissenschaft Bezug nimmt. Dort haben beide „Social Media Marketing“ belegt und gelernt, wie Social-Media-Marketing in der Buchbranche aussehen kann. Ab Minute 00:57 empfiehlt Laura den TikTok-Account von Hugendubel, der nicht nur eine hohe Reichweite hat, sondern auch eine Bandbreite an Interaktionsmöglichkeiten aufweist.
Social Media in der Buchbranche
Ab Minute 02:13 reden Laura und Janina über die Social-Media-Aktivitäten von Verlagen. Rückblickend hat Social-Media-Marketing besonders im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an Relevanz gewonnen. Daraus lässt sich ableiten, dass sich Zielgruppen gezielt ansprechen lassen und der Content an die unterschiedlichen Plattformen angepasst werden kann. Die Bandbreite reicht von Titelvorstellungen mit Autor*innen über Online-Lesungen und Buchtipps bis hin zu Verlosungen. Zudem arbeiten Verlage mit Buchblogger*innen zusammen, woran man sieht, dass sich auch Bewertungsmechanismen verschoben haben. Ab Minute 04:17 gibt Janina ein Beispiel für eine Social-Media-Aktion: Mit der Aktion #buecherhamstern sollte der Ausfall der Leipziger Buchmesse kompensiert werden. Ab Minute 04:55 spricht Laura über die Social-Media-Aktivitäten von Buchhandlungen. Die Relevanz von Buchempfehlungen lässt sich unter dem Motto ‚Alles, was auf dem Buchhandlungsblog gepostet wird, verkauft sich besser‘ fassen. Daneben spielt es eine Rolle, was die Mitarbeiter*innen der Buchhandlungen mit ihren Kund*innen teilen und wie persönlich sie dabei werden wollen. Auch die Frage danach, wie stark und mit welchen Aktionen die Kundschaft eingebunden werden soll, ist zentral. Ab Minute 06:05 geht Laura anhand der Communities, die hinter #bookstagram und #booktok stehen, auf deren Bedeutung für Buchhandlungen ein. Ab Minute 06:40 betonen Laura und Janina, dass sich der Social-Media-Auftritt je nach Sparte der Buchbranche, aber auch abhängig von Zielsetzung, Zielgruppe und Ressourcen, unterscheidet und dass Social Media nicht immer und für jede*n ein sinnvolles Mittel sein kann und muss.
Relevanz von BookTok und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Buchhandels
Ab Minute 08:15 redet Janina über BookTok als neuere Entwicklung, die sich bereits in eigenen Verkaufskategorien widerspiegelt. BookTok spricht durch seine Schnelllebigkeit, bedingt durch die kürzere Verbreitungszeit von Trends, und Nähe zwischen Blogger*innen und Nutzer*innen, die sich vor allem durch den persönlicheren und scheinbar ehrlicheren Austausch ergibt, vor allem eine jüngere Zielgruppe an. Ab Minute 11:25 spricht Laura über die wachsende BookTok-Community mit ihrem direkten Einfluss auf die Verkaufszahlen im Buchhandel. BookTok ist zum Beispiel als Kategorie in Onlineshops oder in Form von Thementischen in Buchhandlungen vertreten. Hieran lässt sich die Relevanz der BookTok-Community für den stationären und Online-Bucheinzelhandel erkennen. Eine weitere Möglichkeit, wie die Community zur Empfehlungsinstanz für andere Kund*innen genutzt werden kann, zeigt die wöchentliche BookTok-Bestsellerliste, die während der Leipziger Buchmesse 2023 veröffentlicht wurde. Ab Minute 12:15 erinnern sich Janina und Laura an ihre Tätigkeit im Bucheinzelhandel zurück, während derer sie eine gesteigerte Nachfrage nach auf BookTok thematisierten Titeln beobachten konnten.
Zusammenfassung und Learning aus der Folge
Ab Minute 13:54 stellt Laura den Zusammenhang zwischen dem Thema dieser Folge und der Buchwissenschaft her. Sie macht deutlich, dass Social Media ein Werkzeug in der Buchbranche sein kann. Zudem hat sich durch die steigende Relevanz von sozialen Medien über die Jahre auch ein neues Berufsfeld im Bereich des Social-Media-Managements herauskristallisiert. Ab Minute 16:53 fasst Janina zusammen, dass Social Media darauf Einfluss haben kann, wie die Branche sich gestaltet, aber auch neu findet, was sich zugleich aus den Beteiligten und deren Ideen ergibt.
Unsere Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch und worum es in der nächsten Folge geht
Ab Minute 17:10 gibt Laura den Impuls, die eigenen buchbezogenen Social-Media-Feeds daraufhin zu betrachten, von welchen Akteur*innen wie Verlagen, Buchhandlungen, Bibliotheken etc. diese stammen, welcher Art der Content ist und welche Wirkung er hat. Ab Minute 18:45 weist Laura auf die nächste und letzte Folge der Staffel 2 hin, in der Janina und Anne wieder einen spannenden Interviewgast haben.
Themendossier Kunden erreichen via Social Media (2019), Buchreport.magazin: Wissen: Verstehen: Handeln, Harenberg Kommunikation Verlags- und Medien GmbH & Co. KG.
Staffel 2, Folge 4: Ideen in between
Worum es in dieser Folge geht und unsere Empfehlung für euch
In der Folge „Ideen in between“ sprechen Janina und Aaron über die Prozesse der Produktentwicklung. Ab Minute 0:15 erzählt Aaron, dass die Folge auf dem Modul Unternehmerische Praxis aus dem dritten Semester aufbaut. Dort haben die beiden zusammen das Seminar „Design x Publishing“ besucht, in dem sie gelernt haben, wie man strukturiert und zielgerichtet Lösungen für mögliche Probleme im Bereich der Buchbranche finden kann, indem dafür bereits existierende oder neue Technologien eingebunden und entwickelt werden. Ab Minute 1:25 empfiehlt Janina am Beispiel der Abholstation einer Buchhandlung, wie es so für die Kund*innen möglich wird, Buchbestellungen jederzeit und unabhängig von Ladenöffnungszeiten abzuholen, und illustriert gleich eine erste Ebene von Problemlösungsstrategien.
Design Thinking
Ab Minute 2:25 reden Aaron und Janina anhand eines Beispiels über die sechs Phasen des „Design Thinking“. Phase 1 stellt die Ermittlung des Problems sowie die Zielstellung dar, zum Beispiel die Vergrößerung der jugendlichen Zielgruppe einer Buchhandlung. In Phase 2 geht es darum, den Ursprung des Problems aufzudecken, beispielsweise, ob die anvisierte jugendliche Zielgruppe überhaupt weiß, was Buchhandlungen für sie bereithalten. In Phase 3 werden die Erkenntnisse aus der vorherigen Phase zusammengetragen. Es könnte somit sein, dass Jugendliche eher in Buchhandlungen gehen würden, wenn sie um das interessante Sortiment wüssten. Phase 4 stellt die eigentliche Ideenfindung dar. Hier würde es darum gehen, die Aufmerksamkeit der Jugendlichen über gezielte Marketingaktionen, beispielsweise über Social Media, zu erregen. In Phase 5 würden Prototypen für notwendige Tools entwickelt, um die in der vorherigen Phase entwickelten Ideen umsetzen zu können, die in der letzten Phase getestet werden. Neue Prototypen und Produktversionen können dabei auch noch Jahre nach Erstveröffentlichung entwickelt und auf den Markt gebracht werden. Ab Minute 5:10 sprechen Aaron und Janina darüber, wie sich dieser Ablauf konkret in ihrem Seminar abgespielt hat. Pro Gruppe wurden die vier Kategorien Zielgruppe, Produkt, Funktion und Technik zugelost. In Aarons Gruppe war es eine Seniorin mit Sehbeeinträchtigung, der mithilfe von Augmented Reality das Lesen von Büchern erleichtert werden sollte. Ab Minute 8:38 beschreibt Janina das Konzept der Persona, das beispielsweise über Alter, Lebenssituation und äußere Einflussfaktoren prototypische Personengruppen ableitet. Aaron geht ab Minute 12:00 am Beispiel einer Augmented-Reality-Technologie auf die Bedeutsamkeit sinnlicher Wahrnehmung und deren Einfluss auf die Produktentwicklung ein. Ab Minute 12:57 illustrieren Aaron und Janina den Marketing Mix und die „4 P“, Product, Promotion, Price und Placement. Anhand des Problemlösers, den sich Janinas Gruppe überlegt hat, einem Tool, das im universitären Kontext Texte zusammenfassen sollte, zeigt sich, dass hier Marketing über die Universität zielführend ist, um die studentische Zielgruppe zu erreichen. Ab Minute 15:00 beschreiben Janina und Aaron den „Business Model Canvas“. In diesem Businessplan wird das Produktkonzept ausführlich beschrieben und in seine verschiedenen Bestandteile zerlegt. Hierunter fallen auch zentrale Partner, Ressourcen oder die Kostenstruktur.
Beispiele aus der Buchbranche
Ab Minute 19:00 sprechen Janina und Aaron über bereits existierende Beispiele aus der Buchbranche. Sie führen zunächst die Tonies an. Dabei handelt es sich um eine Hörtechnologie, die in Form einer Lautsprecherbox Kindern Geschichten über unterschiedliche dort einzusteckende Figuren, die zusätzlich zum Spielen und Sammeln geeignet sind, vorspielt. Eine Weiterentwicklung dieses Produkts stellt die Überlegung dar, die Tonies mit KI zu verknüpfen, damit immer wieder neue Geschichten erfunden werden können. Als nächstes beschreibt Aaron ab Minute 21:45 die App-basierte Lösung von Thalia, womit Lehrer*innen unkompliziert und gebündelt Schulbuchbestellungen aufgeben können. Als letztes Beispiel erläutert Janina ab Minute 23:30, wie man bei Kindle und Audible den Fortschritt von Audio-Book und E-Book synchronisieren kann, um beispielsweise das Sprachenlernen zu erleichtern.
Zusammenfassung und Learning aus der Folge
Ab Minute 25:00 stellt Janina den Zusammenhang vom Thema dieser Folge und der Buchwissenschaft her. Sie macht deutlich, dass die Aspekte des Aufdeckens von Problemen und der Ideenfindung für Problemlöser Thema mehrerer Module der BuWi sind. Aaron fasst die Folge zusammen und stellt als wesentliches Learning heraus, dass nicht jegliches Projekt umsetzbar ist.
Unsere Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch und worum es in der nächsten Folge geht
Ab Minute 26:45 gibt Aaron als Mitmachaufgabe den Impuls, am Beispiel von Technologien aus dem Alltag zu überlegen, welchen Zweck oder welche Zwecke sie erfüllen und aus welchen Vorgängertechnologien sie sich entwickelt haben könnten. Janina gibt ab Minute 27:15 noch den Hinweis auf die nächste Folge, in der sie und Laura über Social Media in der Buchbranche sprechen werden.
Themendossier Innovation in der Buchbranche (2018), Buchreport.magazin: Wissen: Verstehen: Handeln, Harenberg Kommunikation Verlags-
und Medien GmbH & Co. KG.
Staffel 2, Folge 3: Perspektiven in between
Worum es geht und unsere persönliche Empfehlung für euch
Laura steigt in die Folge ein, indem sie den Gedanken hinter der aktuellen Folge „Perspektiven in between“ erklärt, denn der Modulplan sieht ein achtwöchiges Praktikum vor. Hierbei dürfen sich die Studierenden aussuchen, wo sie das machen wollen – beispielsweise im Verlag, der Buchbinderei, im Buchantiquariat und in allen weiteren zur Buchbranche gehörenden Bereichen, grundsätzlich aber auch in der Medienbranche generell, wenn dabei auch schriftbasierte Medien eine Rolle spielen. Ab Minute 0:59 empfiehlt Aaron die Fantasy-Reihe Das Schwert der Wahrheit (The Sword of Truth) von Terry Goodwin. Laura knüpft ab Minute 1:58 an die Buchempfehlung an, indem sie verrät, dass sie es liebt, Empfehlungen zu geben, weshalb sie sich in der Buchhandlung, in der sie neben dem Studium gearbeitet hat, gut aufgehoben gefühlt hat. Sie schlägt damit die Brücke zur heutigen Folge, denn Laura und Aaron werden davon erzählen, was sie während des Studiums oder davor an Erfahrungen in der Buchbranche sammeln konnten.
Lauras und Aarons Erfahrungen in der Buchbranche
Aaron beginnt ab Minute 2:33 damit, über seine Arbeit in der Buchhandlung seines Heimatorts zu sprechen. Dort hat er bereits während seiner Schulzeit ein Praktikum gemacht und seitdem immer wieder wochenweise gearbeitet. Es hat ihm gut gefallen, sowohl vertraute als auch neue Gesichter zu sehen und die Buch- und Lese-Leidenschaft teilen zu können. Gespräche mit Verlagsverteter*innen haben ihm neue Perspektiven eröffnet. Für Aaron ist vor allem der Kontrast deutlich geworden, dass er als Studierender das Buch in erster Linie als Kulturgut gesehen hat. Im Praxisbereich hat er allerdings das Buch als Ware erfahren. Seine Arbeit im Buchhandel hat für ihn den Gebrauch vom Buch „greifbarer“ werden lassen. Laura teilt ab Minute 5:25 ihre Erfahrungen in der Buchbranche und beginnt mit ihrer Zeit vor dem Studium. Hier hat sie, durch die Vermittlung ihres Deutschlehrers, ein fünfwöchiges Praktikum bei einem Stuttgarter Verlag absolviert. Sie macht deutlich, dass vor allem zwei Aspekte wesentlich sind: Zum einen sind Kontakte in die Branche hilfreich, zum anderen ist es oftmals nötig, anders als es sich bei Aarons Schilderung gezeigt hat, den Heimatort für ein Praktikum zu verlassen. Lauras Aufgabenbereiche waren das Korrekturlesen von Manuskripten, das Planen von Cover-Gestaltungen und Schreiben von Klappentexten. Ab Minute 6:55 berichtet Laura von ihrer Zeit als Aushilfe in einer großen Nürnberger Buchhandlung. Dort hat sie sich um das Auspacken und Einräumen der Ware, die Planung und den Aufbau von Thementischen, die Kund*innenberatung, das Nachbestellen von Titeln und das Bearbeiten von Abholbestellungen gekümmert. Ab Minute 7:39 erzählt Laura von ihrer aktuellen Arbeit als Werksstudierende bei einem Nürnberger Kindersachbuchverlag im Bereich Lizenzen. Sie gesteht, dass sie dieses Feld vorher nicht wahrgenommen hat, nun aber vielfältige Aspekte kennenlernt wie das Korrekturlesen von Spezialtiteln, die Betreuung von eigenen kleinen Projekten, die Kontaktpflege zu Lizenznehmer*innen und Repräsentation der Marke sowie die Überprüfung ausländischer Lizenzausgaben auf korrekte Umsetzung. Sie plant außerdem, ihr Praktikum beim selben Verlag im Bereich Offline- und Online-Marketing. zu absolvieren.
Das Nachwuchs-Parlament
Ab Minute 9:52 sprechen Aaron und Laura über das Nachwuchsparlament. Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben zumeist unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen sowohl von ihrem Gegenüber als auch der Art und Weise, die Tätigkeiten auszuführen. Dies zeigt sich auch in der Buchbranche als Arbeitsfeld. Junge Menschen, die dort arbeiten wollen, stellen zunehmend die eigene Lebensqualität in den Vordergrund und fordern eine ausgewogene Work-Life-Balance, Anerkennung für ihre Arbeit und stärkere Einflussnahme und damit Sichtbarkeit. Dies wird beispielsweise im Börsenblattartikel Der Nachwuchs wird rarer und selbstbewusster thematisiert. Arbeitgeber hingegen wollen oft auf bewährte Weise weiteragieren. Allerdings ist der Wandel der Buchbranche und der entsprechenden Berufsfelder unleugbar, so dass ein „Weiter-so“ nicht möglich ist. Hier bringt Laura ab Minute 12:03 das Nachwuchsparlament ins Spiel, weil dort die Menschen zusammenkommen, die in der Zukunft die Branche mitgestalten und begründen werden. Das Nachwuchsparlament ist ein Forum des Börsenvereins, welches in Form einer jährlichen, zweitägigen Fortbildung Azubis, Studierende, Volontär*innen und Praktikant*innen, also die zukünftige Arbeiterschaft der Buchbranche, über aktuelle Themen und Entwicklungen der Branche informiert. Aaron erzählt, dass das diesjährige Thema, das Fachkräfte-Empowerment, der Ausgangspunkt war, um nach Ideen und Lösungen, die potentiellen Arbeitskräften zugutekommen sollen, zu suchen.
Aarons und Lauras 5-Jahres-Plan
Laura fragt in Minute 13:30, wo Aaron sich in 5 Jahren sieht. Aaron erachtet sein Praktikum als Findungsphase, denn er möchte ein längeres Praktikum machen, bei dem er mehrere Stationen absolvieren kann. Auch könnte er sich noch eine Ausbildung nach dem Studium vorstellen und hat Lust, wieder in die Praxis zu gehen. Laura macht sich ab Minute 15:37 stark dafür, dass man sich nach dem Studium noch Zeit nehmen darf, um herauszufinden, was man genau machen möchte, da es darum geht, sich für einen Beruf zu entscheiden, den man mit Freude ausübt. Lauras ursprünglicher Plan war es, Lektorin zu werden. Jetzt könnte sie sich aber, auch durch ihre absolvierten Praktika, eine Tätigkeit im Verlag im Bereich Lizenzen und Marketing vorstellen. Ebenfalls denkbar ist für sie, als Buchhändlerin in einer kleinen, unabhängigen Buchhandlung zu arbeiten. Aaron hebt hervor, dass die breit aufgestellte Ausrichtung des BuWi-Bachelors vielfältige Möglichkeiten eröffnet, einzelne Bereiche zu vertiefen. Zudem muss der Master nicht zwangsläufig direkt nach dem Bachelor begonnen werden, sondern kann sich an eine Phase des Sammelns von Berufserfahrung anschließen.
Zusammenfassung und Learning aus der Folge
Ab Minute 19:27 formuliert Aaron den Wunsch, mit der Folge einen kleinen Eindruck von möglichen Tätigkeitsfeldern vermittelt zu haben – auch um künftig der klassischen Frage von Verwandten, „Buchwissenschaft? Was ist das und was macht man denn damit?“, begegnen zu können. Laura fasst ab Minute 20:11 das Learning der Folge folgendermaßen zusammen: Die BuWi ist, auch durch die Kombination mit einem zweiten Fach (bei Laura Soziologie, bei Aaron English & American Studies), immens vielfältig und es gibt zudem so viele verschiedene Berufe und Bereiche innerhalb der Buchbranche, aus denen man nach dem Studium wählen kann.
Unsere Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch
Ab Minute 21:06 stellt Aaron die Mitmach-‚Aufgabe‘ der Folge vor, die darin besteht, sich einen eigenen 5-Jahres-Plan zu überlegen. Als Impulsgeber für potentielle Arbeitsbereiche nennt er die folgenden Fragen: „Welche Schritte sind bei der Buchentstehung involviert?“ „Was passiert alles mit dem fertigen Buch?“ „Und wo sehe ich mich dabei?“
Worum es in der nächsten Folge geht
Laura leitet ab Minute 22:02 zur Folge vier über, in der es mit Aaron und Janina um Ideen in der Buchbranche und wie diese entwickelt werden gehen wird.
Cronau, S. (2023): „Der Nachwuchs wird rarer und selbstbewusster“. In: Börsenblatt. Das Fachmagazin für die Buchbranche.
Börsenverein des deutschen Buchhandels (2023): Nachwuchsparlament.
Staffel 2, Folge 2: Zuschreibungen in between
Worum es geht und unsere Empfehlung für euch
In der zweiten Folge der zweiten Staffel geht es um Zuschreibungen an das Buch und das Konzept des Dritten Orts. Beides soll gemäß dem Überthema der Staffel „BuWi in action“ weitergedacht und auf Buchhandlungen übertragen werden. Mit Rückgriff auf die letzte Folge stellt Aaron ab Minute 1:04 das besondere Gefühl der Zugehörigkeit und Gemeinschaft heraus, das sich einstellt, wenn man in „seine“ Buchhandlung „seiner“ Stadt geht. Anne startet ab Minute 1:30 mit ihrer Empfehlung des Cafés Kaffeefleck in der Erlanger Buchhandlung Thalia. Ihr gefällt es, dort nach Seminaren und Vorlesungen zu entspannen. Das Café kann man sich als Dritten Ort vorstellen, wenn man das klassische Konzept weiterdenkt, wie es Anne und Aaron tun wollen.
Das Konzept des Dritten Orts
Ab Minute 2:53 führt Anne in das Konzept des Dritten Orts, das auf den Soziologen Ray Oldenburg zurückgeht, ein. Es handelt sich dabei um einen Ort fernab des eigenen Zuhauses, der sich aus Menschen zusammensetzt, die regelmäßig kommen, um sich miteinander auszutauschen. Es treffen dort Menschen unterschiedlichen Alters und sozialen Status aufeinander, die sich sonst nicht oder nicht zwangsläufig begegnen würden. Aaron nennt ab Minute 3:55 als aktuelles Beispiel das vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen geförderte Programm „Dritte Orte – Häuser für Kultur und Begegnung im ländlichen Raum“, bei dem es um die Entwicklung und Weiterentwicklung von Kulturorten in ländlichen Regionen geht. Darunter fallen beispielsweise Dorfgemeinschaftshäuser, Bibliotheken sowie Buchhandlungen. Dem Kulturministerium nach fallen diese Einrichtungen unter Dritte Orte als kulturell geprägte Einrichtungen, als Ankerpunkte für kulturelle Vielfalt mit einem Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Der Dritte Ort in der Buchhandlung
Anne überträgt das Konzept des Dritten Orts ab Minute 4:50 auf Buchhandlungen. Sie bezieht sich dabei auf Faith Jones, der für diesen Ansatz für den Zeitraum von 1910 bis 1920 eine jüdische Buchhandlung in Kanada betrachtet hat. Die Buchhandlung diente der jüdischen Community, die von Flucht und Vertreibung betroffen war, als Ort der Vergemeinschaftung. Ab Minute 5:45 denkt Aaron das Konzept, bezogen auf zeitgenössische Buchhandlungen, weiter. Dort bieten Cafés, Lesungen oder regelmäßig stattfindende Buchclubs die Möglichkeit, dass Gleichgesinnte zusammenkommen können. Spezielle Gemeinschaften können beispielsweise über Buchpakete für Familien oder Treffs für Spieleliebhaber*innen angesprochen werden. Andersherum gedacht lassen sich Communities erst herausbilden, indem weniger buchaffine Menschen durch Buchhandelskooperationen mit anderen Geschäften wie Bäckereien und Blumenläden oder Veranstaltungen wie Kalligraphiekurse und Grillabende in Buchhandlungen gelockt werden. Indem die Menschen sich wohlfühlen, kann sich ein Gefühl von Zugehörigkeit einstellen.
Das Buch und seine Zuschreibungen
Ab Minute 9:45 sprechen Anne und Aaron darüber, was das Besondere an Buchhandlungen ist. In erster Linie stellen Buchhandlungen Orte des Komforts dar, weil man weiß, was einen erwartet. Darüber hinaus verbringt man über den Buchkauf hinaus Zeit, die durch Stöbern oder den Austausch mit anderen bestimmt ist. Ab Minute 12:45 geht Anne darauf ein, inwieweit das Buch „zeichenhaft“ verwendet wird. Buchnutzung geht dann über das reine Lesen hinaus, indem sich Menschen mit Alltagsgegenständen oder Dekoartikeln in Buchform umgeben sowie in Kleidung mit Buchaufdruck usw. zeigen. Darin spiegeln sich positive Zuschreibungen an das Buch. Lassen sich Menschen vor (ihren) Bücherregalen fotografieren oder sind Bücher Teil einer Werbekampagne, sollen die Betrachter*innen positive Assoziationen zur inszenierten Person oder zum in Szene gesetzten Produkt haben.
Zuschreibungen und der Dritte Ort
Ab Minute 17:45 erfolgt die Verknüpfung von Zuschreibungen mit dem Dritten Ort. Als Beispiel kann man hier Buchclubs nennen, da sie den Austausch mit anderen Lesenden über geteilte Literaturerlebnisse und generell das Zusammenkommen von Menschen, die Büchern eine besondere Wertschätzung entgegenbringen, ermöglichen. Denkbar sind auch Filmabende zu Literaturverfilmungen oder Treffen, um gemeinsam buchaffine Dinge wie Notizbücher für Lesetagebücher, das Buch mit Geheimfach oder das Buch als Kunstobjekt zu basteln.
Was all das mit der Buchwissenschaft zu tun hat und unsere Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch
Anne führt die Inhalte der Folge ab Minute 19:45 mit den Studieninhalten der BuWi zusammen. So sollte die Folge dazu anregen, über neue Konzepte für die Buchbranche nachzudenken. Aaron fasst die Folge ab Minute 20:15 noch einmal kurz zusammen. Er hält fest, dass die positiven Zuschreibungen an Bücher sich im Sinne des Dritten Orts positiv für Buchhandlungen nutzen lassen, indem sie als Orte der Entspannung, des Wohlfühlens und Gemeinschaftsgefühls stark gemacht werden. Ab Minute 20:45 regt Anne die Zuhörer*innen dazu an darüber nachzudenken, ob sie Dritte Orte kennen oder wie sie sich solche vorstellen würden. Zudem fragt sie nach Zuschreibungen, die die Zuhörer*innen an Bücher haben und fordert sie auf, weiter über diese nachzudenken.
Worum es in der nächsten Folge geht
Aaron gibt ab Minute 21:50 einen Überblick über die nächste Folge, in der er mit Laura über ihre bisherigen Berufserfahrungen und mögliche zukünftige Arbeitsfelder redet.
Der Dritte Ort:
Jones, F (2010/11). „Everybody Comes to the Store: People’s Book Store as Third Place, 1910-1920.“ In: Canadian Jewish Studies / Études Juives Canadiennes 18/19, (pps. 95–119).
Oldenburg, R. (1999). The Character of Third Places: The Great Good Place. Marlowe & Co.
Zuschreibungen:
Rautenberg, U. (2005). Das Buch in der Alltagskultur: Eine Annäherung an zeichenhaften Buchgebrauch und die Medialität des Buches. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU).
Kurschus, S. (2015). European Book Cultures: Diversity as a Challenge. Springer VS.
Staffel 2, Folge 1: Buchhandel in between
Worum es geht und unsere persönliche Empfehlung für euch
Die erste Folge der zweiten Staffel startet mit neuen Stimmen und steht unter dem Motto „BuWi in action“, wobei wir während der gesamten Staffel einen Blick in die Buchbranche werfen. Laura startet ab Minute 0:29 mit einer Buchempfehlung für das Buch Babel von Rebecca F. Kuang und erzählt, dass dieses Buch in den letzten Wochen sowohl auf Social Media als auch im stationären Buchhandel omnipräsent war. Besonders gefallen haben ihr der Dark-Academia-Vibe und dass sie im Buch viel über Sprache und verschiedene Kulturen gelernt hat. Anne berichtet, dass sie das Buch auf Lauras Empfehlung hin in einer kleinen Buchhandlung gekauft hat, woraufhin beide ab Minute 1:44 überlegen, in welchen Situationen sie lieber im stationären Buchhandel Bücher kaufen und in welchen online bestellen. Ab Minute 2:47 erklärt Laura, dass Folge 1 auf dem Seminar „Zukunft Buchhandel“ basiert, das Anne und Laura im Modul „Unternehmerische Praxis“ in ihrem zweiten Semester besucht haben. Im Seminar ging es darum, wie der Buchhandel seine Zukunft gestalten und mit Herausforderungen umgehen kann.
Grundlagen des stationären Buchhandels
Anne beginnt ab Minute 3:15 mit den Grundlagen. Der Sortimentsbuchhandel zeichnet sich durch ein Ladengeschäft, einen Webshop und ein Sortiment am Lager aus. Außerdem bieten Buchhandlungen verschiedene Dienstleistungen an, wie z.B. Veranstaltungen oder Beratung. Buchhandlungen lassen sich grundsätzlich anhand ihres Sortiments, also ihres Angebots, in allgemeine Buchhandlungen mit breit gefächertem und Fachbuchhandlungen mit spezialisiertem Angebot unterscheiden. Das Sortiment kann stationär, also im Ladengeschäft, angeboten werden, oder ambulant, also über den Onlineshop, wobei auch viele kleine Buchhandlungen mittlerweile einen Webshop anbieten. Laura vertieft ab Minute 5:11 den Aspekt der Fachbuchhandlungen, indem sie deren spezialisiertes Konzept und die spezifische Zielgruppe herausstellt. Dies veranschaulicht sie am Beispiel einer unabhängigen Buchhandlung aus Berlin, deren Fokus auf Frauen* und queeren Personen liegt. Unabhängige Buchhandlungen sind inhabergeführt und keinem übergeordneten Konzern zugehörig, während Filialisten Teil einer Unternehmenskette sind. Ab Minute 6:51 diskutieren Anne und Laura, dass sich die Buchhandlungen, in die sie gerne gehen, v.a. durch das ausdifferenzierte Angebot, gerne erweitert um zusätzliche Artikel, Thementische und gute Beratung auszeichnen.
Umgang mit Herausforderungen, v.a. während der Corona-Pandemie
Ab Minute 7:55 sprechen Anne und Laura über die Corona-Pandemie als Herausforderung für den Buchhandel. Zwar freuten sich große Buchfilialisten wie Thalia Mayersche, Hugendubel und Osiander über einen enormen Kund*innenzuwachs und steigende E-Commerce-Umsätze, allerdings konnten die Profite aus dem Onlinegeschäft die ausbleibenden Einnahmen der geschlossenen Buchhandlungen nicht kompensieren. Laura geht ab Minute 8:59 darauf ein, welche Maßnahmen der stationäre Buchhandel ergriffen hat, um trotz der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Schließungen des Einzelhandels seine Kundschaft erreichen zu können: Der Fokus wurde auf Online-Strategien wie vermehrtes Posten auf Social Media, Lesungen mit Autor*innen per Livestream oder Livestream-Empfehlungsrunden von Buchhändler*innen gelegt. Der Verkauf der Ware wurde über Click & Collect, Bücherlieferung per Fahrradkurier oder den Aufbau von Online-Shops geregelt. Flexibilität und Kreativität spielten eine große Rolle. Ab Minute 10:56 diskutieren Laura und Anne, welche Maßnahmen über Corona hinaus sinnvoll wären und kommen zu dem Ergebnis, dass es die Mischung aus Kompetenzen aus dem stationären Bereich in Kombination mit Social-Media-Strategien ist, wobei sowohl die Kernzielgruppe im Blick behalten werden muss als auch neue Zielgruppen angesprochen werden sollten.
Zukunft des Buchhandels
Ab Minute 13:36 sprechen Laura und Anne über das Stichwort Digitalisierung. Auch im stationären Buchhandel spielt Digitalisierung eine Rolle, da die Buchbranche sich seit den 1990er Jahren mit einem Digitalisierungsprozess konfrontiert sieht. Auf Stufe des Vertriebs war das vor allem das Aufkommen des E-Commerce, also des elektronischen Handels. Spielten damals neue Wettbewerber wie Amazon eine Rolle, sind mittlerweile neue hinzugekommen, wie beispielsweise Apple. Die Relevanz des Onlinehandels wird anhand von Umsatzzahlen deutlich: 2021 erzielte die deutsche Buchbranche 27 % ihres Gesamtumsatzes über den Onlinehandel und 39 % über den stationären Handel. Ab Minute 15:30 tauschen Anne und Laura sich über die Vor- und Nachteile, die stationärer Buchhandel und Onlinehandel haben, aus. Annes Fazit lautet, dass stationäres Geschäft und Onlineauftritt zusammengedacht werden und den Kund*innen auf beiden Kanälen das Gefühl geben müssen, mit ihren*seinen Bedürfnissen gesehen und verstanden zu werden. Auch ein gewisser Wohlfühlfaktor, sowohl stationär als auch online, ist wichtig für die Kundenbindung.
Zusammenfassung und Learning aus der Folge
Laura bringt ab Minute 19:12 den Zusammenhang zwischen dem Thema der Folge und den Studieninhalten damit auf den Punkt, dass der stationäre Buchhandel ein wiederkehrendes Thema im Studium ist und ein mögliches Arbeitsfeld der BuWi Studierenden darstellt. Anne stellt ab Minute 19:38 heraus, dass es besonders die Kreativität der Buchbranche war, die ihr aus der Corona-Pandemie herausgeholfen hat. Für die Zukunft des Buchhandels braucht es auch ohne Krise diese Kreativität und dafür wiederum Menschen, die diese Herausforderung annehmen wollen: zum Beispiel euch da draußen, die ihr uns gerade zuhört.
Mitmach-‚Aufgabe‘ für die Zuhörer*innen
Ab Minute 20:19 stellt Laura die Mitmach-‚Aufgabe‘ der Folge vor, die darin besteht, sich an besondere Momente im stationären Buchhandel zurückzuerinnern. Für Laura war dies die besondere Präsentation der Bücher im Pride-Month im Juni, Anne hebt Empfehlungskärtchen hervor. Beiden Aspekten gemeinsam ist die Liebe zum Detail.
Worum es in der nächsten Folge geht
Anne leitet ab Minute 21:29 zur Folge 2 über, deren Themen „Zuschreibungen“ und „Dritter Ort“ auch in Verbindung mit der heutigen Folge stehen. Inwiefern, das erfahrt ihr, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet!
Grundlagen:
Pohl, S., Umlauf, K. (2018). Der Sortimentsbuchhandel: Ein Lehrbuch. Hauswedell.
Umgang mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie:
Traxel, E., Meyer, A. (2021): Die paradoxe Branche: Vom eigenen Erfolg überrascht. In: BuchMarkt.
Zukunft des Buchhandels:
Börsenverein des Deutschen Buchhandels (2022): Branchenumsatz und Branchenentwicklung.
Hiller, S. (2016). Buchhandelsstrategien im digitalen Markt: Reaktionen der großen Buchhandelsketten auf technologische Neuerungen. De Gruyter.
Staffel 2, Trailer: Ihr könnt gar nicht genug kriegen von BuWi in between?
Intro: Aufsteigende Saxophonklänge, Seitenblättern, weibliche Stimme sagt „BuWi in between“, ein Buch wird durchgeblättert und zugeschlagen
Janina: Herzlich Willkommen zurück bei BuWi in between.
Anne: Ich bin die Anne.
Janina: Und ich bin Janina.
Anne: Hallo zurück bei BuWi in between. Schon die zweite Staffel mittlerweile. Krass, wie die Zeit vergeht. Und wir haben heute zwei neue Stimmen dabei. Laura und Aaron.
Laura: Hallo, ich bin die Laura.
Aaron: Und ich bin der Aaron.
Janina: Dann begrüßen wir schon mal unsere neuen Teammitglieder für die ganz aufregende Staffel 2.
Anne: Ja, wir sind vier Mitglieder jetzt und wechseln mal ein bisschen durch in den Folgen. Aber vorher starten wir mit dem kleinen Funfact über uns.
Aaron: Jawoll. Ich will grad mal anfangen. Also, wie gesagt, ich bin der Aaron. Ich komm‘ aus dem Schwabenländle, wie man es vielleicht schon hört, und ich koch‘ meine Spätzle gern selber. [Lachen]
Janina: Hat er uns leider noch nicht mitgebracht.
Aaron: Leider, sagt ihr.
Laura: Ich bin Laura und ich hab‘ noch nie ein Gedicht auswendig gelernt, weil ich immer meine Hausaufgabengutscheine in der Schule dafür benutzt hab‘. Ein Skill, würde ich sagen.
Janina: Ja. Auf jeden Fall. Gute Organisation. Schon ganz früh auf. [Lachen]
Anne: Schade, dass es in der Uni nicht mehr geht.
Janina: Ja, true. [Kichern] Bräuchte ich auch, so einen Hausaufgabengutschein.
Anne: Ja und ich hab das Puzzeln jetzt als neues Hobby für mich entdeckt. Macht sehr viel Spaß und es ist sehr beruhigend.
Janina: Wie viele Teile sind so dein Ding?
Anne: Tausend. Aber es dauert.
Janina: Hörst du dann Musik dazu? Oder Podcasts?
Anne: Ich hör gern Hörbücher [Lachen], aber auch Podcasts. Passt beides sehr gut dazu.
Janina: Kommt vielleicht ja nochmal vor in der Staffel. Genau. Ich weiß gar nicht mehr genau, was mein Funfact für letztes Mal war. Bin ich ganz ehrlich.
Anne: Ich glaub‘, du hattest erzählt, dass du gern in Cafés gehst.
Janina: Das stimmt.
Laura: Passend.
Janina: Und ist auch passend für diesen Funfact. Weil ich glaub‘, Anne hat diesen mal vorgeschlagen, so in die Runde geschmissen, dass ich immer alle …
Aaron: Fast alle!
Janina: Fast alle mit Kaffee versorge. Aber zu meiner Verteidigung: ich glaub‘, du trinkst gar keinen Kaffee.
Aaron: Ich trink keinen Kaffee. Nein.
Janina: Du trinkst gar keinen Kaffee, also ist es gar nicht meine Schuld. Deswegen aber ab jetzt ein Erfrischungsgetränk.
Aaron: Genau, ich wollt‘ es grad sagen. Wenn es im Sommer dann 28 Grad grade schon im Juni hat, dann ist so ein kaltes Wasser oder so auch nicht schlecht.
Janina: Kein Problem. Bin ich dabei. Bin schon dran.
Laura: Ja, wie Anne vorhin schon gesagt hat, das ist mittlerweile schon die zweite Staffel von BuWi in between und dieses Mal ist das Überthema aber ein anderes. Es ist BuWi in Action. Aber was kann man sich dabei eigentlich vorstellen?
Aaron: Ja. Wir wollen euch mitnehmen in die Veranstaltungen, die wir auch selber schon bisher besucht haben. Und würden euch da eben an den Erfahrungen teilnehmen lassen, die wir selber auch sammeln konnten.
Anne: Ja, wir haben wieder sechs Folgen für euch, wie in der ersten Staffel. Und wir starten in der ersten Folge mit einem Einblick in den stationären Buchhandel und dessen Zukunft.
Aaron: Genau. In der zweiten Folge wollen wir dann über das Konzept vom dritten Ort reden und was Buchhandlungen damit überhaupt zu tun haben.
Laura: In der dritten Folge dreht sich alles um die Frage, was wir später mal machen wollt [sic] oder ob ihr schon wisst, was ihr später mal machen wollt. Und wir stellen euch unsere Erfahrungen vor und was wir während dem Studium schon gemacht haben so.
Janina: Genau. Und dann geht es schon in die vierte Folge. Da geht es um Ideen und Innovationen in der Buchbranche. Was hat die Branche verändert und formen können? Oder was kommt jetzt auch noch? Wir sprechen dann darüber, wie Ideenfindung ablaufen kann und welche Ideen dann auch schon in den letzten Jahren umgesetzt wurden.
Laura: In Folge fünf geht‘s dann um Social Media in der Buchbranche und wie Social Media vielleicht als Tool dort sinnvoll eingesetzt werden kann.
Janina: Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der Staffel 2. Ganz aufregend wieder. Lasst euch überraschen. Die letzte Folge ist wieder was Besonderes wie auch letztes Mal. Wir führen wieder ein Interview mit einem spannendem Mysterygast. [Kichern] Also seid gespannt.
Anne: Freut euch auf eine neue Staffel. Auf BuWi
Janina: in
Laura: between
Outro: Absteigende Saxophonklänge
Staffel 1, Folge 6: Forschung in between
Worum es geht und die persönliche Empfehlung unseres Gasts, Dr. Axel Kuhn, für euch
Die 6. Folge von BuWi in between ist die letzte Folge der ersten Staffel und für dieses Staffelfinale haben Anne und Janina Dr. Axel Kuhn zu Gast, der als Wissenschaftler am Institut für Buchwissenschaft arbeitet. Zu Beginn führt Anne in das Thema der Folge, das akademische Lesen, ein. Damit schließt sich der Kreis zur ersten Folge, in der ebenfalls bereits das Thema Lesen behandelt wurde. In dieser Folge bringt Axel die Empfehlung mit. Ab Minute 1:35 empfiehlt er, ein Lesetagebuch, beispielsweise in Form einer App, zu führen. Dies funktioniert für Romane genauso wie für Texte, die man im Studium liest. Damit lässt sich u.a. festhalten, was man wo gelesen hat und woran man sich beim Gelesenen erinnert.
Axels Werdegang und die Idee zur Studie Who gets lost
Ab Minute 3:53 erzählt Axel, wie er zur Buchwissenschaft gekommen ist. Er hat Medienwissenschaft, Soziologie und Buchwissenschaft studiert und dann zu Games, genauer zu World of Warcraft, promoviert. Ihn interessiert seit je her vor allem die Nutzung von Medien und was dabei passiert, wenn man sie nutzt, sowohl bezogen auf einzelne Mediennutzende als auch mit Blick auf die Gesellschaft. Bei den Games ist ihm aufgefallen, dass er ganz viel liest, woraus sich allmählich der Schwerpunkt seiner jetzigen Forschung ergab. In der Studie Who gets lost? How digital academic reading impacts equal opportunity in higher education, die Axel mitveröffentlicht hat, geht es ums akademische Lesen. Ab Minute 5:30 reden Janina, Anne und Axel darüber, wie ein akademischer Text beschaffen sein sollte, damit es Spaß macht, ihn zu lesen. Für Axel ist ein Text dann gut, wenn dieser ihn herausfordert, zum Nachdenken bringt und neue Ideen enthält. Für viele Studierende jedoch sollte ein Text vor allem kurz und leicht zu lesen, aber auch gut strukturiert sein. Axels Ausgangspunkt für das Projekt war genau der Widerspruch zwischen Viel-Lesen im Studium, ohne Spaß daran zu haben.
Der Forschungsprozess
Ab Minute 8:41 erzählt Axel genauer vom Hintergrund der Studie. Bei diesem Forschungsprojekt war er der Initiator, da er auch bereits vorher schon gemeinsam mit Studierenden kleinere qualitative Erhebungen zum Thema Lesen im Studium durchgeführt hat. Die Coronakrise war der Startpunkt für die Studie, da sich hier noch deutlicher gezeigt hat, wie oft man digitale Medien nutzt und Texte für das Studium in digitaler Form liest. Dabei hat sich Axel gefragt, welche Auswirkungen die Digitalisierung von Texten auf Lernprozesse und Studienerfolgschancen hat und inwiefern dabei auch ungleiche Chancen für einzelne Studierendengruppen geschaffen werden. Für die Studie hat er mit Wissenschaftler*innen aus dem Netzwerk Leseforschung zusammengearbeitet, die aus unterschiedlichen Disziplinen, wie z.B. Pädagogik, Literaturwissenschaft oder Soziologie, kommen. Auf die einzelnen Prozessschritte geht Axel ab Minute 11:17 ein. Nach einem Kennenlernen der Wissenschaftler*innen über Zoom wurden der Prozessablauf, die einzelnen Zwischenziele und die zeitliche Planung festgelegt. Das Team einigte sich auf eine Onlinebefragung, da die Studierenden wegen der Coronapandemie zuhause vor ihrem Computer saßen, um an digitalen Lehrveranstaltungen teilnehmen zu können. Während in der Befragung über 100 Fragen gestellt wurden, beispielsweise zu Formaten digitaler Texte und deren Einsatz in unterschiedlichen Fächern oder zu Emotionen beim Lesen wissenschaftlicher Texte, konnte im Paper zur Studie lediglich auf ca. zehn Fragen, deren Fokus auf sozialer Ungleichheit lag, näher eingegangen werden. Von Hürden im Zusammenhang mit der Studie erzählt Axel ab Minute 16:00. Hier erklärt er, dass vor allem Aspekte wie Datenschutz und hochschulpolitische Angelegenheiten zu berücksichtigen waren. Daneben galt es, die verschiedenen Interessen der einzelnen Wissenschaftler*innen bei den Fragen zusammenzubringen. Auch die Auswertung des Fragebogens war aufwendig.
Interessante Ergebnisse der Studie
Ab Minute 20:00 geht es um zentrale Ergebnisse der Studie. Eines der interessantesten Ergebnisse ist für Axel, dass Emotionen in Bezug auf Texte ein Hindernis für Studierende darstellen. Sie möchten Texte nicht lesen, auch nicht in digitaler Form, da sie keine Lust auf sie haben oder Angst haben, an ihnen zu scheitern. Das wirkt sich auf Verstehen, Lernverhalten und Lernerfolg aus. Es hat sich gezeigt, dass es unterschiedliche Lesegruppen gibt, die jeweils anders mit digitalen Texten umgehen. Manche Studierende benutzen digitale Texte instrumentell (sie lesen den Text, ohne dessen Format zu hinterfragen) und eine kleinere Gruppe kann damit überhaupt nicht umgehen. Diese Studierenden drucken die Texte aus und sind nicht willens oder in der Lage, mit digitalen Spezifika umzugehen. Dadurch sind sie von Teilen des Studiums ausgeschlossen und haben andere Bildungschancen. Außerdem gibt es Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern (Da die Fallzahlen der non-binären Geschlechter für statistisch belastbare Aussagen zu gering waren, wurden in der Studie die Unterschiede im Leseverhalten von Männern und Frauen ausgewertet.). Die Daten unterscheiden sich in vielen Bereichen. Männer nutzen digitale Texte lieber, Frauen hingegen schätzen sich wesentlich schlechter im Umgang mit digitalen Medien ein, als sie eigentlich sind. Männer erlernen eher instrumentelles Lesen, wohingegen Frauen v.a. das klassische, in fiktionale Welten eintauchende Lesen lernen. Diese Art des Lesens können sie aber beim akademischen Lesen nicht anwenden, weshalb sich aus diesem Widerspruch Ungleichheiten in Verstehen, Lesepraxis und emotionalen Wirkungen ergeben.
Möglichkeiten, um das digitale Lesen im Studium zu unterstützen
Die Frage, wie man Studierende im Lesen unterstützen kann, diskutieren Anne, Janina und Axel ab Minute 29:18. So sollte man nach Axel Studierende dazu bringen, ihr eigenes Leseverhalten zu reflektieren. Sie sollten sich fragen, warum sie negative Emotionen mit dem Lesen verbinden und was sie daran ändern könnten. Studierende sollten akzeptieren, dass es nicht schlimm ist, am wissenschaftlichen Lesen zu scheitern, weil diese Art des Lesens erst eingeübt werden muss. Auch eröffnen Widerstände beim Lesen die Möglichkeit, überhaupt etwas zu lernen. Zudem geht es nicht darum, Texte möglichst schnell zu lesen, sondern sie erfordern Zeit, auch abhängig von Stimmung und Motivation. Und zuletzt sollten sich Studierende nicht mit anderen vergleichen.
Axels Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch
Ab Minute 32:40 geht Janina noch einmal auf Axels Tipp ein, sich zu fragen, wo man überall wissenschaftliche Texte liest und selbst auch ein Lesetagebuch zu führen. Anne greift den Aspekt auf, wo anders zu lesen. Axel selbst liest seit dem Studium besonders gerne an Badeseen, in Biergärten oder in Cafés. Er betont, dass v.a. die Tatsache, sich für das Lesen an einen anderen Ort zu begeben, förderlich sei, weil es ein geplantes Vorhaben ist.
Ausblick auf den neuen Master Schriftmedienkultur und Digitale Transformation – und auf die nächste Staffel von BuWi in between
Ab Minute 35:24 macht Anne noch kurz Werbung für den neuen Master Schriftmedienkultur und Digitale Transformation, der dieses Jahr im Wintersemester startet und für den man sich noch bis zum 15.07 bewerben kann. Janina gibt abschließend einen Ausblick auf die neue Staffel von BuWi in between, die bereits in Planung ist mit neuen Stimmen und neuer Perspektive unter dem Überthema ‚BuWi in action‘. Weiter geht’s ‚in between‘ Juli!
Kuhn, A. et al. (2022). Who gets lost? How digital academic reading impacts equal opportunity in higher education. In: New Media & Society. Alker-Windbichler, S. et al. (2022). Akademisches Lesen. Medien, Praktiken, Bibliotheken. V&R unipress.
Forschungsprojekte PD Dr. Axel Kuhn Netzwerk Leseforschung Master Schriftmedienkultur und Digitale Transformation ab Wintersemester 2023/24
Staffel 1, Folge 5: Hören in between
Worum es geht und unsere persönliche Empfehlung für euch
In der 5. Folge von BuWi in between geht es ums Hören von Hörbüchern per Streaming. Zu Beginn ab Minute 0:27 gibt Janina eine Empfehlung, und zwar das Hörbuch Anxious People (auf Deutsch: Eine ganz dumme Idee) von Fredrik Backman. Das Buch haben Anne und Janina für ihren Buchclub gelesen, wobei Janina zusätzlich das Hörbuch gehört hat. Ihr haben dabei vor allem der Vortrag der Sprecherin gefallen und die kurzen Kapitel in Songlänge. Besonders letzteres kam ihrem Hören in Unterwegssituationen entgegen. Das Nebenbeihören von Hörbüchern ist eines der Themen, die in dieser Folge behandelt werden.
Was ein Hörbuch ist und was es ausmacht
Anne stellt ab Minute 3:53 die Frage, was überhaupt ein Hörbuch ist. Dabei nennt sie Janina verschiedene Begriffe und lässt sie raten, ob man diese unter den Begriff Hörbuch fassen kann. Dabei stellt sich heraus, dass ein Hörbuch mehr ist als nur ein vorgelesenes Buch. In einer Buchhandlung werden nicht nur eingelesene Bücher verkauft, sondern beispielsweise auch Hörspiele.
Auditive Inhalte werden beliebter
Ab Minute 6:35 geht Janina näher darauf ein, wer eigentlich alles Hörbücher hört. Es lässt sich feststellen, dass auditive Inhalte wieder beliebter werden, vor allem bei der jüngeren Generation. Die Generation Boomer hört verglichen mit anderen Generationen eher weniger Hörbücher auf Streamingplattformen (z.B. Apple Podcasts, Spotify).
Rezeption & Nutzung
Das Modul, in dem Janina und Anne sich mit dem Hören von Hörbüchern beschäftigt haben, nennt sich Rezeption & Nutzung. Anne erklärt ab Minute 10:18 den Begriff Rezeption, worunter man das Aufnehmen von Aussagen und Wertvorstellungen versteht. Dabei untersucht man auch das Mediennutzungsverhalten von Rezipient*innen und stellt sich die Frage, was bei der Informationsverarbeitung allgemein passiert und warum manche Informationen aufgenommen, andere hingegen ignoriert werden.
Auswirkung der Coronapandemie auf die Hörbuchnutzung
Ab Minute 11:25 geht Janina näher auf die Hörbuchnutzung während der Coronapandemie ein. Hierbei ließ sich feststellen, dass es eine steigende Nachfrage nach Streamingangeboten gab und sich Hörsituationen verändert haben, es wurde z.B. mehr zuhause gehört.
Wie verändert sich das Hören durchs Streaming?
Anne und Janina diskutieren ab Minute 13:15, inwiefern sich das Hören durchs Streaming verändert. Das Hörbuch wird oft als Double-your-time-Medium bezeichnet, da es die Möglichkeit bietet, es neben einer anderen Beschäftigung zu hören, man kann seine Zeit also verdoppeln. Das wirkt sich jedoch auf die Hörsituation und die Aufmerksamkeit aus. Ein Großteil der Rezipierenden hört Hörbücher zur Entspannung zuhause. Viele hören aber auch, wenn sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, um ‚verlorene‘ Zeit sinnvoll zu füllen. Anne merkt ab Minute 15:50 an, dass das Nebenbeihören sich sehr stark auf die Aufmerksamkeit auswirkt, weil sie dadurch immer geteilt ist. Beim Autofahren muss man sich z.B. auf das Fahren und das Gehörte konzentrieren. Es gibt auch verschiedene Auffassungen darüber, inwiefern das Genre eines Hörbuchs beeinflusst, ob eine Tätigkeit nebenbei ausgeführt werden kann. Daran anschließend diskutieren Janina und Anne ab Minute 17:40 anhand verschiedener Einflussfaktoren, wie sinnvoll es ist, eine Tätigkeit neben dem Hören auszuführen.
Was all das mit der Buchwissenschaft zu tun hat und unsere Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch
Ab Minute 24:12 erläutert Anne den Zusammenhang zwischen Hörbüchern und Buchwissenschaft. Hörbücher sind Teil der Buchbranche, werden in Buchhandlungen verkauft und von Verlagen produziert. Janina führt die einzelnen Aspekte ab Minute 24:55 zusammen. Dabei hält sie fest, dass das Hören von gestreamten Inhalten vor allem bei der jüngeren Generation immer beliebter wird und auch Hörbücher immer öfter nebenbei gehört werden. Dabei beeinflusst dies jedoch die Aufmerksamkeit beim Hören. Janina gibt ab Minute 26:07 auch noch eine kleine Mitmach-‚Aufgabe‘ weiter, und zwar sollen die Zuhörer*innen darauf achten, wann und wie oft sie Hörbücher nebenbei hören.
Worum es in der nächsten Folge geht
Die nächste Folge wird eine besondere Folge, denn es wird weg von den Seminaren und hin zur Forschung an unserem Institut gehen. Dabei ist Dr. Axel Kuhn zu Gast. Er wird anhand des von ihm mit herausgegebenen Buchs Akademisches Lesen aufzeigen, wie Studierende wissenschaftliche Texte im digitalen Umfeld lesen und welche Ungleichheiten sich hieraus ergeben können.
Hörbuch:
Rühr, S. (2008). Tondokumente von der Walze zum Hörbuch: Geschichte – Medienspezifik – Rezeption. V&R unipress.
Rezeption:
Pöhls, J. (2013). Rezeption. In G. Bentele (ed.): Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaft (2nd ed., p. 301). Springer VS.
Hörbuchhören:
Rost, K. (2016). Absorption – Aufhorchen – Überhören. Aufmerksamkeitsdynamiken des Hörbuch-Hörens. In S. Bung & J. Schrödl (eds.): Phänomen Hörbuch (pp. 189–210). transcript.
Die Corona-Pandemie und ihr Einfluss auf das Hörbuchhören:
Snelling, M. (2021). The Audiobook Market and Its Adaptation to Cultural Changes. In: Publishing Research Quarterly 37, (pps. 642–656).
Tattersall Wallin, E. (2022). Visualising mobile audiobook practices before and during the pandemic: A case with Swedish young adults. University of Borås.
Staffel 1, Folge 4: Kommunikation in between
Worum es geht und unsere persönliche Empfehlung für euch
In der 4. Folge von BuWi in between geht es um das Thema Kommunikation und Kommunikationssteuerung, allgemein in der Medien- und speziell der Buchbranche. Zu Beginn gibt es wie immer eine Empfehlung. Janina und Anne erzählen ab Minute 0:42 von dem Film She Said, den sie zusammen im Kino gesehen haben. In dem Film geht es um die Aufdeckung des Missbrauchsskandals rund um den Filmproduzenten Harvey Weinstein. In der Folge soll es unter anderem um die Frage gehen, wie Kommunikation in der Öffentlichkeit gesteuert und reguliert wird, worum es indirekt auch in dem Film geht.
Kurzer Rückblick auf Folge 1
Anne gibt ab Minute 2:15 einen kurzen Rückblick auf die erste Folge des Podcasts, in der das Thema Kommunikation bereits behandelt wurde. Dabei ging es unter anderem darum, wie Kommunikation mit unterschiedlichen Modellen dargestellt und dass sie auch sehr variabel aufgefasst werden kann.
Direkte und indirekte Regulierung
Janina geht ab Minute 3:20 auf den Unterschied zwischen direkter und indirekter Regulierung und Steuerung ein. Bei der direkten Regulierung wird die Kommunikation beispielsweise von staatlicher Seite unmittelbar beeinflusst, wie z.B. in Form des Buchpreisbindungsgesetzes. Bei der indirekten Regulierung wird die Kommunikation mittelbar beeinflusst, was z.B. durch Marktmechanismen passieren kann. Diese regulieren, wie und wann Mediengüter hergestellt werden und wie so Kommunikation stattfindet. Janina gibt hier als Beispiel die Veröffentlichung von Büchern und wer genau hierüber bestimmt.
Regulierung von Kommunikation in der Vergangenheit
Anne geht ab Minute 5:53 auf die Regulierung von Kommunikation in der Vergangenheit näher ein. Dabei nennt sie als Beispiel die NS-Zeit, in der viele Schrift- und Lesemedien verboten wurden, Bücher nicht gedruckt werden durften oder auch verbrannt wurden.
Gegenwärtige Formen von Regulierungen
Janina geht ab Minute 8:15 auf Bücherverbote in den USA näher ein. Dabei werden Bücher in Schulen verboten, die vor allem mit Sexualität, Rassismus und amerikanischer Geschichte zu tun haben. Vergleichbare Phänomene finden sich auch im Internet. Anne erklärt ab Minute 11:40 die Begriffe Filterblasen und Echokammern genauer und geht näher auf mögliche Gefahren ein. Ein weiteres aktuelles Phänomen sind Fake News, die Janina ab Minute 14:00 thematisiert.
Gatekeeping in der Buchbranche
Ab Minute 16:00 gehen Anne und Janina näher auf die Kommunikation in der Buchbranche ein. Sie stellen sich die Frage, warum Informationen selektiert werden. Findet dieser Mechanismus im Internet statt, führt dies häufig zu Kritik. Derselbe Vorgang in der Medienbranche wird jedoch gar nicht wahrgenommen. Anne und Janina zeigen, dass Selektion ein notwendiger Schritt ist. Ein Beispiel sind Manuskripte, bei denen der Verlag darüber entscheidet, welche gedruckt werden. Dabei gibt es objektive Kriterien wie Erfolgsaussichten, Qualität oder Konkurrenzprodukte, aber auch subjektive wie Gefallen, wonach Verlage ihre Auswahl treffen. Bei Buchhandlungen spielen Budget, Platz und Kundschaft eine Rolle.
Was all das mit der Buchwissenschaft zu tun hat und unsere Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch
Direkt daran anschließend geht Janina ab Minute 26:25 auf den Zusammenhang zur BuWi ein. In der Folge ging es um die Regulierung von Schrift- und Lesemedien, vor allem auch im Bezug zur Buchbranche. Hierbei stellt sich die Frage, warum es bei Büchern keine FSK-Angaben gibt, bei Telemedien jedoch schon. Hier schließt sich auch der Denkanstoß für die Zuhörenden an: Sollte es solche Angaben geben? Wie weit sollten Schrift- und Lesemedien reguliert werden?
Worum es in der nächsten Folge geht
In der nächsten Folge geht es um die Frage, wie wir Medien rezipieren und nutzen, was wir uns beispielhaft am Hören gestreamter Hörbücher genauer ansehen wollen.
Kommunikationssteuerung und -regulierung:
Hepp, A. (2021). Auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft. Über die tiefgreifende Mediatisierung der sozialen Welt. Halem.
Filterblase:
Pariser, E. (2012). Filter bubble: Wie wir im Internet entmündigt werden. Hanser.
Gatekeeper: Hagenhoff, S. (2015). Verlage und Buchhandel als Organisationen zur Bereitstellung von Lektüre. In U. Rautenberg, U. Schneider (Eds.), Lesen: Ein interdisziplinäres Handbuch (pp. 623–652). De Gruyter.
Leyrer, K., Hagenhoff, S. (2022). Digitale Souveränität in der medienvermittelten öffentlichen Kommunikation: Die Beziehung zwischen Rezipient*in und Gatekeeper. In G. Glasze, E. Odzuck & R. Staples (eds.), Digitale Souveränität Diskurse, Praktiken und Voraussetzungen von „individueller“ und „staatlicher Souveränität“ im digitalen Zeitalter (pp. 247–286). Transcript.
Staffel 1, Folge 3: Orga in between
Rückblick auf Folge 2
Paula geht kurz auf die Mitmach-‚Aufgabe‘ und Denkanstöße der letzten Podcast-Folge ein und diskutiert sie mit Anne und Janina. Dabei gelangen alle drei zu der Erkenntnis, dass Empfehlungen variieren können, abhängig davon, wer oder was sie ausgesprochen hat, und dass sie auch nicht zwangsläufig auf Interesse stoßen müssen.
Worum es geht und unsere persönliche Empfehlung für euch
In der heutigen Folge geht es um Organisationsleistungen, beziehungsweise genauer um die Buchpreisbindung. Anne spricht ab Minute 2:46 über Bücherkisten vor Buchhandlungen, worin sich Mängelexemplare zu einem niedrigeren Preis befinden. Diese sind von der Buchpreisbindung enthoben und können daher günstiger angeboten werden.
Was ist die Buchpreisbindung? Warum gibt es sie?
Ab Minute 4:00 erklären Janina und Anne was die Buchpreisbindung ist und zeigen auf, dass damit das Kulturgut Buch geschützt wird, indem es ein breites Buchangebot von vielen unterschiedlichen Verlagen gibt, das über ein dichtes Netz an Buchhandlungen verbreitet wird.
Was sind Organisationen? Wie funktionieren sie?
Ab Minute 6:00 geht Anne auf das Thema Organisation ein und erklärt, dass Dinge und Abläufe organisiert werden müssen, damit beispielsweise ein Verlag läuft, indem jede*r Akteur*in auf das übergeordnete Ziel, wie hier zum Beispiel das Produzieren und Veröffentlichen von Büchern, hin arbeitet. Ab Minute 7:15 wird der Begriff Organisation noch einmal von Institution unterschieden und Janina erläutert, dass Institutionen Regeln sind und Organisationen sozusagen die Spieler*innen, die danach spielen. Dies veranschaulicht Paula am Beispiel des Pokerspiels ab Minute 7:45, was Anne dann ab Minute 8:35 auf die Buchpreisbindung rückbezieht. Um das Thema genauer erläutern zu können, greift Paula ab Minute 9:16 die Initiative Fair Lesen auf, die den Buchmarkt unter dem Motto „Schreiben ist nicht umsonst. Gegen die Zwangslizensierung. Für Vielfalt und Meinungsfreiheit.“ beeinflusste und für viele Diskussionen sorgte. Dazu beschreibt Anne noch einmal die Wertschöpfungskette, um deutlich zu machen, an welcher Stelle und auf welche Weise es zum Konflikt zwischen Autor*innen und Bibliothek kommt. Dass sich dieser jedoch nicht auf die Aussage „Neuerscheinungen werden nahezu kostenlos über die Onleihe der Bibliotheken angeboten, so dass Autor*innen ihrer Einnahmequellen beraubt werden.“ reduzieren lässt, sondern differenziert betrachtet werden muss, zeigen die weiteren Ausführungen und Diskussionspunkte von Paula, Anne und Janina. Ab Minute 17:19 sprechen sie noch über den Aspekt Kaufmotivation und wodurch diese, neben dem Faktor Zeit, beeinflusst wird sowie die Funktionen, die Bibliotheken übernehmen.
Was all das mit der Buchwissenschaft zu tun hat und unsere Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch
Unsere Mitmachaufgabe für euch schließt sich direkt (ab Minute 22:05) an und wird von Paula gestellt: Was erachtet ihr als wirklich fair? Ab Minute 22:30 stellt Janina den Bezug zur Buchwissenschaft her, die sich dafür interessiert, wie alle Teile des Buchmarkts als Akteure eines übergeordneten Systems, aber auch als einzelne Organisationen funktionieren und durch Institutionen verändert und beeinflusst werden.
Worum es in der nächsten Folge geht
In der nächsten Folge geht es um das spannende und aktuelle Thema Cancel Culture. Wir führen euch damit in Fragestellungen aus unserem Modul Kommunikation und Kommunikationssteuerung ein.
Buchpreisbindung:
Lutz, P. (2015). Preisbindung. In U. Rautenberg (ed.), Reclams Sachlexikon des Buches: Von der Handschrift zum E-Book (3rd ed., pp. 315–316). Reclam.
Wertschöpfung in der Buchbranche:
Wirtz, B. W. (2006). Medien- und Internetmanagement (5th ed.). Gabler.
Hintergrund der ‚Fair Lesen‘-Initiative:
SWR (2021). Initiative „Fair Lesen“ sieht literarische Freiheit durch E-Book-Ausleihe bedroht.
Staffel 1, Folge 2: Technik in between
Rückblick auf Folge 1
Anne klärt über die Frage aus Folge 1 auf, zeigt auf, wie viel man im Alltag eigentlich liest und geht dabei auf Instagram-Captions, Straßenschilder und Co. ein.
Worum es geht und unsere persönliche Empfehlung für euch
In dieser Folge geht es um Empfehlungen und Empfehlungssysteme. Ab Minute 1:44 stellt Janina eines ihrer Lieblingsbücher, Normal People, von Sally Rooney vor und zeigt damit schon eine Art der Empfehlung, nämlich die mündliche Form. Um zur Folge überzuleiten, erklärt sie, wie sie auf den Titel aufmerksam wurde.
Was Soziotechnische Systeme sind und welche Bestandteile sie haben
Ab Minute 5:12 erklärt Anne den Begriff Technik genauer und zeigt auf, dass man darunter alles vom Menschen künstlich Geschaffene versteht, was dazu dient, ein „Problem“ zu lösen. Zur Veranschaulichung macht sie mit Janina und Paula ein kleines Raterätsel, bei dem sie Dinge vorstellt und nachfragt, ob es sich um Technik handelt oder nicht. Neben Technik gibt es auch noch andere Bestandteile von soziotechnischen Systemen, worauf wir ab Minute 10:09 eingehen. Paula erklärt hier zunächst, was Organisationen sind, da soziotechnische Systeme durch geordnete und organisierte Abläufe gekennzeichnet sind. Anne geht ab Minute 11:16 am Beispiel der Buchbranche genauer auf die Wertschöpfungskette und damit die einzelnen Akteure und Abläufe ein. Janina sagt ab Minute 13:47 etwas zum Aspekt „sozio“, das Zusammenwirken verschiedenster Menschen, und führt alles noch einmal zusammen. Hieran wird deutlich, dass die Bestandteile zusammenhängen und nicht ohne einander funktionieren. Anne vertieft ab Minute 14:47, was unter „Distribution“ zu verstehen ist, nämlich die Auswahl der Titel durch die Buchhändler*innen für ihre Buchhandlungen und die Verteilung der Bücher an die Endkund*innen.
Was Empfehlungssysteme sind und wie sie funktionieren
Ab Minute 16:14 beginnt Paula zu erklären, dass Empfehlungssysteme Entscheidungshilfen sind. Rund um Bücher tragen sie beispielsweise dazu bei, einen Überblick über die Vielzahl an Titeln zu erlangen. Dies veranschaulicht Anne ab Minute 17:50 am Beispiel von Empfehlungen durch Buchhändler*innen. Sie verrät dabei auch ein schönes Erlebnis aus der Zeit, als sie selbst noch als Buchhändlerin tätig war. Paula leitet ab Minute 20:12 zu Empfehlungsmechanismen im digitalen Raum über. Dazu ist es notwendig, ein Verständnis von Algorithmen zu erlangen, worauf Janina ab Minute 21:30 eingeht, indem sie Anne und Paule dazu befragt. Dabei wird deutlich, dass ein Algorithmus nicht nur etwas Digitales ist, sondern auch im Analogen vorkommt und Verwendung findet. Weiterhin zeigt sich, dass algorithmenbasierte Empfehlungen häufig negative Zuschreibungen erhalten.
Was all das mit der Buchwissenschaft zu tun hat und unsere Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch
Ab Minute 27:30 fasst Anne noch einmal alles, was im Zusammenhang mit soziotechnischen Systemen steht, zusammen. Da sich die BuWi allgemein mit Schrift- und Lesemedien beschäftigt, spielen in diesem Falle Kulturtechniken eine wichtige Rolle, die durch Technologien unterstützt werden. Die Organisationen der Buchbranche sind wiederum grundlegend für Schrift- und Lesemedien. Paula führt ab Minute 29:50 alle Aspekte zusammen. Ab Minute 30:48 findet ihr unsere kleine Mitmachfrage für euch: Wo ist überall Technik und wo findet ihr überall Empfehlungsmechanismen? Wie oft begegnet ihr dem Wort Algorithmus und wie ist das Wort im jeweiligen Kontext konnotiert?
Worum es in der nächsten Folge geht
In der nächsten Folge wird es um Organisationsleistungen und deren Zusammenhang zu digitalen Aspekten gehen. Dabei wartet ein spannendes und aktuelles Beispiel auf euch!
Soziotechnische Systeme:
Hagenhoff, S. (2020). Medieninnovationen und Medienrevolutionen. In J. Krone, J., T. Pellegrini (eds), Handbuch Medienökonomie (). Springer VS.
Algorithmen:
Hagenhoff, S. (2020). Gegen die Diskussion mit den drei Unbekannten – Daten, Algorithmen und Digitalisierung (Erlanger Beiträge zur Medienwirtschaft 13). Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU).
Lackes, R., Siepermann, M., Lübbecke, M. (2018). Algorithmus. In Gabler Wirtschaftslexikon. Springer Nature.
Staffel 1, Folge 1: Lesen in between
Worum es geht und unsere persönliche Empfehlung für euch
Anne stellt zu Beginn der ersten Folge unseres neuen Podcasts das Thema vor. Es soll um die Frage gehen, was Lesen ist, womit sich auch alle Erstsemester in der Einführungsveranstaltung auseinandersetzen. Ab Minute 0:37 steigt Paula direkt mit einem Beispiel ein. Sie empfiehlt einen Besuch des botanischen Gartens in Erlangen. Am Beispiel des Lesens der Schilder der verschiedenen Pflanzenarten kommen wir direkt auf das Thema Lesen zu sprechen. Denn zu Beginn des Studiums bekommen alle Erstsemesterstudierenden immer zwei Fragen gestellt: Was ist ein Buch? Was ist Lesen?
Was Kommunikation ist und Kommunikationsmodelle
Dass Lesen auch Kommunikation ist, diskutieren wir ab Minute 1:46. Dadurch, dass wir die ganze Zeit lesen (z.B. Instagram-Captions, WhatsApp-Nachrichten etc.), kommunizieren wir auch ständig. Paula stellt das Kommunikationsmodell von Karl Bühler vor (ab Minute 3:10). Dabei gibt es eine*n Sender*in, eine*n Empfänger*in und eine Botschaft. Die Botschaft, oder der Sachinhalt, wird in Form eines sprachlichen Zeichens vermittelt, in unserem Beispiel ist das die Schrift. So funktioniert das auch beim Lesen. Der*die Autor*in ist der*die Sender*in, der*die Leser*in ist der*die Empfänger*in und das Geschriebene ist die Botschaft. Man braucht aber noch mehr zum Kommunizieren, darauf gehen wir ab Minute 4:03 ein. Es werden auch noch Regeln benötigt. Das sieht man am Kommunikationsmodell von Stewart Hall. Dort muss die Botschaft erst kodiert und dann enkodiert werden. Das kann man sich ein bisschen wie Geheimbotschaften früher in der Schule vorstellen, als man sich mit dem*der besten Freund*in Nachrichten in einer geheimen Sprache geschrieben hat, die nur das Gegenüber verstehen konnte. So hat man das Mitgeteilte in eine eigene Sprache bzw. Schrift kodiert und der*die Freund*in musste das enkodieren. Wenn man diese Sprache oder Schrift nicht kennt, dann ist es auch nicht möglich, sie zu verstehen. Ab Minute 5:34 kommen wir auf das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun zu sprechen. Sein Nachrichtenquadrat mit vier Seiten einer Nachricht umfasst Appell, Sachinhalt, Beziehungsebene und Selbstoffenbarung. Janina erläutert das anhand eines Beispiels: Zwei Menschen sitzen in einem Auto und stehen an einer roten Ampel. Die mitfahrende Person sagt zur fahrenden: „Es ist grün.“ Neben dem bloßen Sachinhalt schwingt als Appell die Aufforderung endlich loszufahren mit. Genauso sagt die Nachricht etwas über die Beziehung der beiden Personen zueinander aus. Wichtig ist hierbei, dass dies nur eine mögliche Interpretation neben vielen ist. Paula erweitert das Beispiel, das auf interpersonelle Kommunikation ausgelegt ist, auf schriftliche Kommunikation (ab Minute 7:40). Die Nachricht in diesem Fall ist ein Zettel der Mutter mit der Information: Kauf 4 Eier! Eine mögliche Interpretation, bezogen auf das Ausrufezeichen ist, dass man Dinge leicht vergisst. Genauso gibt es einen Hinweis auf die Beziehung, da die Mutter den Imperativ verwenden kann, ebenso wie den Appell, dass die Eier endlich gekauft werden sollen. Das Beispiel von Schulz von Thun lässt sich zwar vor allem auf Massenkommunikation anwenden, zum Beispiel ein Buch, das vermarktet und verkauft wird. Wir haben das Beispiel hier dennoch zur Veranschaulichung gewählt, da wir zeigen wollen, dass Kommunikation sehr vielfältig ist. Ab Minute 10:26 kommen wir noch einmal auf das Kodieren und Enkodieren von Nachrichten zurück. Hierbei geht es nicht nur um das Verständnis von einzelnen Wörtern und Sprache, sondern auch um Schrift. Nach Ferdinand de Saussure weiß man, dass es sich bei der Buchstabenfolge B-A-U-M um einen Baum handelt und man hat auch sofort ein Bild davon im Kopf.
Warum all das in der BuWi eine Rolle spielt und unsere Mitmach-‚Aufgabe‘ für euch
Janina führt die besprochenen Inhalte ab Minute 11:10 noch mit dem Studium der Buchwissenschaft zusammen. Da sich die BuWi allgemein mit Schrift- und Lesemedien beschäftigt, bildet das Thema Lesen dessen Grundlage. Ein Buch ist ein Medium, dessen Inhalt über Schrift vermittelt wird. Abschließend gibt Paula den Zuhörenden noch eine kleine Aufgabe mit auf den Weg (ab Minute 12:26): Achtet doch mal darauf, wo und was ihr überall lest. Uns selbst ist dabei aufgefallen, dass es viel mehr ist, als man eigentlich denkt. Man ist unbewusst viel öfter Empfänger*in von Kommunikation.
Worum es bei der nächsten Folge geht
In der nächsten Folge wird es um das Thema Technik gehen und um die Frage, wie Mensch und Technik zusammenarbeiten. Dabei schauen wir uns Empfehlungsmechanismen genauer an und welche Rolle diese in der BuWi spielen.
Burkart, R. (2021). Kommunikationswissenschaft (6th ed., pp. 44–56). Böhlau.
Kuhn, A., Rautenberg, U. (2015). Lesen. In U. Rautenberg (ed.), Reclams Sachlexikon des Buches: Von der Handschrift zum E-Book (3rd ed., pp. 257–260). Reclam.
Röhner, J., Schütz, A. (2016): Psychologie der Kommunikation (3rd ed., pp. 27–51). Springer.
Staffel 1, Trailer: Ihr wollt mehr wissen?
Intro: Seitenblättern, weibliche Stimme sagt „BuWi in between“, ein Buch wird durchgeblättert und zugeschlagen
Paula: Willkommen bei BuWi in between. Wir sind das Podcast-Team der Buchwissenschaft der Friedrich Alexander Universität in Erlangen. Ich bin Paula,
Janina: Ich bin Janina.
Anne: Und ich bin die Anne.
Paula: Und wir wollten uns einmal ganz kurz bei euch vorstellen. Wie gesagt, ich bin Paula, ich studiere im 4. Fachsemester Buchwissenschaft und mein Zweitfach ist Germanistik. Wenn man einen kleinen Fun-Fact über mich wissen möchte, dann, dass ich super gerne Lego baue und letztes Wochenende einen Lego-Bonsai-Baum gebaut habe. Wie siehtʼs bei euch aus?
Janina: Also ich bin immer noch Janina, auch. [Lachen] Mache im Zweitfach English und American Studies und auch wenn ich wahrscheinlich gerne auch einen Bonsai-Baum bauen würde, gehe ich einfach auch richtig gerne in Cafés und höre gerne Podcasts, gehe gern spazieren. Da findet man mich sehr wieder am Wochenende. Und bei dir?
Anne: Ich bin die Anne. Ich studiere im 4. Semester auch Buchwissenschaft und im Zweitfach Philosophie und ich mache in meiner Freizeit total gerne Sport. Ich habe jetzt so ein bisschen Kung Fu für mich entdeckt. Kann ich nur empfehlen, macht wirklich megaviel Spaß.
Paula: Anne kann nämlich zum Beispiel Hechtrollen über Sachen drüber machen. [Lachen]
Anne: Noch nicht, das würde ich gerne können, kann ich aber nicht.
Janina: Sie ist unsere Security, einfach. [Lachen]
Anne: Noch nicht. [Lachen] So, eine kurze Info zu unserem Podcast und zwar ist der von Studierenden für Studierende.
Paula: Aber nicht nur das, sondern er ist auch für die Branche und für alle, die sich für die BuWi interessieren.
Janina: Aber was ist die BuWi überhaupt?
Anne: Naja, wenn wir von BuWi – also, das ist die Kurzform für Buchwissenschaft, das ist übrigens sehr süß, wie ich finde, [Lachen] – wenn wir davon reden, dann stellen wir uns meistens so ʼne Gruppe von WissenschaftlerInnen vor, die sich über dieses kodexförmige Buch – dieses viereckige Teil – unterhalten, das man in der Buchhandlung kaufen kann. [Schmunzeln]
Paula: Manche denken wahrscheinlich noch ein bisschen in Richtung Literaturwissenschaft und dass wir uns in der BuWi vier Stunden lang über Goethes Faust unterhalten werden.
Anne: Hoffentlich nicht.
Paula: Tun wir nicht, keine Angst. Der ein oder andere geht dann schon weiter, wahrscheinlich tatsächlich Richtung Medium Buch, also das Ding überhaupt: Was kann das, was macht das, wozu ist das da? Aber das ist alles nur ein Teilbereich. Die BuWi und so vor allem das Studium der Buchwissenschaft, das wir drei alle studieren, ist sehr viel mehr.
Janina: Genau. Weil, generell geht es eigentlich um Mediennutzung. Also: Wie rezipieren wir das, wie nehmen wir es auf oder wahr, wo lässt es sich überall anwenden, wo finden wir es auch überall wieder? Also, die BuWi ist nicht nur eine Analyse von z.B. so Druckvorgängen, sondern auch hauptsächlich die Auseinandersetzung mit aktuellen Trends der Digitalisierung – was auch in dieser Staffel auch ein großes Thema sein wird [Lachen], kleiner Spoiler – und allgemein den Wandel des Buchmarkts.
Paula: Genau, und um diesen Graben zu schließen, zwischen dem, was die BuWi ist und dem, was als die BuWi betrachtet wird, und den im besten Fall entweder zu überqueren oder tatsächlich schließen zu können, dafür machen wir diesen Podcast. BuWi
Janina: in
Anne: between.
Anne: Wir wollen euch noch einen kurzen Überblick über diesen Podcast geben und was euch in den nächsten Folgen erwartet. Also, grundsätzlich gehen wir nach unserem eigenen Semesterplan vor, den stellt euch Paula noch ein bisschen näher vor.
Paula: Genau, nämlich so wie wir sechs Fachsemester studieren –
Anne: – also in den meisten Fällen – [Lachen]
Paula: – Im Normalfall – haben wir pro Staffel 6 Folgen. Es gibt ein übergeordnetes Thema. Das ist in der ersten Staffel, die wir behandeln, die Digitalisierung oder die digitalen Themen der BuWi und jede Folge hangelt sich so ein bisschen an unserem Modulhandbuch entlang. Das könnt ihr euch, wenn ihr ganz eifrig seid, auch angucken. Wir werden das dann in der Folge unten verlinken.
Anne: Genau. Auch andere AutorInnen bzw. WissenschaftlerInnen, die wir in den einzelnen Folgen erwähnen, da schreiben wir die genauen Quellen auch immer in die Captions. Also, wenn ihr euch weiter einlesen wollt, dann könnt ihr da einfach drauf klicken und findet dann die ganzen Information dazu.
Paula: In der nächsten Folge z.B. beschäftigen wir uns mit etwas, was wir alle im ersten Semester thematisieren, nämlich der Einführung in die BuWi und der brennenden Frage: Was ist Lesen?
Janina: Wir wollen euch jetzt allgemein zeigen, was die BuWi überhaupt ausmacht, und das ist vor allem eins:
Paula, Janina und Anne: Vielfalt. [Schmunzeln]
Paula: Und das warʼs mit BuWi
Janina: in
Anne: between.
Staffel 1, Teaser: Worum geht’s in aller Kürze?
Intro: Seitenblättern, weibliche Stimme sagt „BuWi in between“, ein Buch wird durchgeblättert und zugeschlagen
Paula: Und um diesen Graben zu schließen zwischen dem, was die BuWi ist, und dem, als was die BuWi betrachtet wird, und den im besten Fall entweder zu überqueren oder tatsächlich schließen zu können, dafür machen wir diesen Podcast. BuWi
Janina: in
Anne: between.
Anne: Wir wollen euch noch einen kurzen Überblick über diesen Podcast geben und was euch in den nächsten Folgen erwartet. Also, grundsätzlich gehen wir nach unserem eigenen Semesterplan vor, den stellt euch Paula noch ein bisschen näher vor.
Paula: Genau, nämlich so wie wir sechs Fachsemester studieren –
Anne: – also in den meisten Fällen – [Lachen]
Paula: – Im Normalfall – haben wir pro Staffel 6 Folgen. Es gibt ein übergeordnetes Thema. Das ist in der ersten Staffel, die wir behandeln, die Digitalisierung oder die digitalen Themen der BuWi und jede Folge hangelt sich so ein bisschen an unserem Modulhandbuch entlang.
Janina: Wir wollen euch jetzt allgemein zeigen, was die BuWi überhaupt ausmacht, und das ist vor allem eins:
Paula, Janina und Anne: Vielfalt!